Aktuelles
-
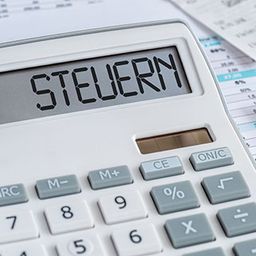
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos verlängert
Der Bundesrat hat am 19.12.2025 das „Achte Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes“ gebilligt. Damit wurde die Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge um fünf Jahre verlängert.Durch die Gesetzesänderung wird das Halten reiner Elektrofahrzeuge begünstigt, die bis zum 31.12.2030 erstmals zugelassen oder komplett auf Elektroantrieb umgerüstet werden. Bisher galt die Steuerbefreiung für bis zum 31.12.2025 erstmal zugelassene/umgerüstete Fahrzeuge. Hinweis: Die Steuerbefreiung gilt maximal zehn Jahre und wird längstens bis zum 31.12.2035 (bisher: 31.12.2030) gewährt.Quelle: Achtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, BGBl. 2025 I Nr. 342 vom 22.12.2025; NWB
-

Steueränderungsgesetz 2025 verabschiedet
Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Steueränderungsgesetz 2025 zugestimmt. Das Gesetz wurde inzwischen im Bundesgesetzblatt verkündet, sodass wesentliche Regelungen am 1.1.2026 in Kraft treten.Das Gesetz umfasst im u.a. folgende Maßnahmen: Die Entfernungspauschale, die für Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte gilt, steigt ab 2026 von 0,30 € pro Entfernungskilometer auf 0,38 € pro Entfernungskilometer.Hinweis: Bislang galt eine Entfernungspauschale von 0,38 € erst für Entfernungen ab dem 21. Entfernungskilometer, während für die ersten 20 Entfernungskilometer eine Pauschale von 0,30 € gewährt wurde. Nach der Neuregelung gilt somit ab dem ersten Kilometer eine einheitliche Entfernungspauschale von 0,38 € pro Entfernungskilometer. Die Mobilitätsprämie, die für Arbeitnehmer gedacht ist, die ein geringes Einkommen und die einen Arbeitsweg von mehr als 20 km haben, wird unbefristet ausgestaltet. Bislang war sie bis einschließlich 2026 befristet. Der Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen wird ab dem 1.1.2026 auf 7 % gesenkt; dies betrifft die Umsätze aus dem Verkauf von Speisen (also ohne Getränkeausschank), unabhängig davon, ob sie im Restaurant verzehrt oder mitgenommen werden. Von dem reduzierten Steuersatz sollen nicht nur klassische Restaurants und Hotels profitieren, sondern auch Bäckereien, Metzgereien, Catering-Unternehmen sowie Anbieter im Bereich Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung. Die sog. Übungsleiterpauschale, die für Ausbilder, Erzieher und Betreuer gilt und eine Steuerfreiheit anordnet, wird ab dem 1.1.2026 von 3.000 € auf 3.300 € angehoben. Die sog. Ehrenamtspauschale, die für nebenberufliche Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich gilt und ebenfalls eine Steuerfreiheit bestimmt, wird ab dem 1.1.2026 von 840 € auf 960 € erhöht.Daneben sind im Bereich der Gemeinnützigkeit u.a. folgende Änderungen beschlossen worden: E-Sport, also der Wettkampf in Video- und Onlinespielen, wird ab dem 1.1.2026 offiziell als gemeinnützig anerkannt. Gemeinnützige Körperschaften, insbesondere Vereine, sind grundsätzlich verpflichtet, ihre Mittel möglichst zügig für steuerbegünstigte Satzungszwecke auszugeben. Die bisher geltende Freigrenze dieser Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung wird von 45.000 € auf 100.000 € erhöht. Die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen werden künftig für gemeinnützige Körperschaften steuerlich unschädlich sein. Die Freigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe gemeinnütziger Körperschaften wird von 45.000 € auf 50.000 € (einschließlich Umsatzsteuer) jährlich angehoben. Bis zu dieser Höhe entsteht weder Körperschaft- noch Gewerbesteuer. Anders ist dies jedoch, wenn die Freigrenze von 50.000 € auch nur um 1 € überschritten wird, da dann der gesamte Betrag steuerpflichtig wird.Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurden folgende Reglungen neu aufgenommen, die nun ebenfalls ab dem 1.1.2026 gelten:Gewerkschaftsmitglieder können künftig ihren Gewerkschaftsbeitrag zusätzlich zu bestehenden Pauschbeträgen und Werbungskosten vom zu versteuernden Einkommen absetzen. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Höchstbeträge für die Abzugsfähigkeit von Parteispenden zu verdoppeln. Für Arbeitnehmer mit einer doppelten Haushaltsführung im Ausland ist folgende Regelung relevant: Hier wird grundsätzlich für die Unterkunftskosten ein Höchstbetrag von 2.000 € im Monat festgeschrieben.Quelle: Steueränderungsgesetz 2025, BGBl. 2025 I Nr. 363; NWB
-
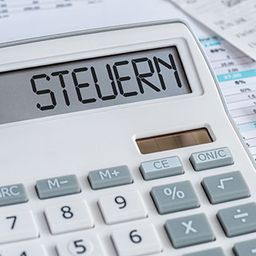
Grunderwerbsteuer: Bemessungsgrundlage bei Übernahme eines sog. Ökokontos
Der Zahlung für den Erwerb eines Grundstücks stellt die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer dar, auch wenn ein Teil der Zahlung auf ein sog. Ökokonto entfällt. Die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer mindert sich daher nicht um den Anteil der Zahlung, der auf das Ökokonto entfällt.Hintergrund: Der Kaufvertrag über ein Grundstück löst Grunderwerbsteuer aus, die sich grundsätzlich nach dem Kaufpreis richtet. Kommt es zu einem Eigentumswechsel an einem Grundstück, ohne dass es einen Kaufvertrag gab, unterliegt der Eigentumswechsel der Grunderwerbsteuer.Das Ökokonto, auf dem Ökopunkte eingetragen werden, repräsentiert einen besonderen naturschutzrechtlichen Grundstückszustand. Es geht beim Verkauf des Grundstücks auf den Käufer über.Sachverhalt: Die Klägerin erwarb im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens ein Grundstück und zahlte hierfür eine Abfindung an den vorherigen Eigentümer. Der vorherige Eigentümer hatte für das Grundstück die Einrichtung eines Ökokontos beantragt und das Ökokonto erhalten. Nach der Abfindungsvereinbarung entfiel ein der Höhe nach benannter Anteil der Abfindung auf das Ökokonto. Die Klägerin machte geltend, dass die Bemessungsgrundlage um den auf das Ökokonto entfallenden Anteil der Abfindung zu mindern sei.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage ab: Der Eigentumsübergang an dem Grundstück unterlag der Grunderwerbsteuer. Da es keinen Kaufvertrag und auch keine Grundstücksauflassung gab, weil die Eigentumsübertragung im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens erfolgte, ist der Erwerb des Eigentums – und nicht der Kaufvertrag, wie sonst üblich – grunderwerbsteuerbar. Zwar kann nach dem Gesetz der Erwerb des Eigentums an einem Grundstück im Flurbereinigungsverfahren steuerfrei sein. Dies setzt aber voraus, dass der Erwerber auch Flächen in das Flurbereinigungsverfahren eingebracht hat. Dies war im Streitfall nicht der Fall, sondern die Klägerin hatte ein Grundstück erworben, das nicht mehr zur Abfindung benötigt wurde, weil andere Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens auf eine Abfindung in Land (d.h. in Grundstücken) verzichtet hatten. Zur grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage gehört auch der auf das Ökokonto entfallende Teil der Abfindung. Denn die auf dem Ökokonto gutgeschriebenen Ökopunkte sind fest mit dem Grundstück verbunden, da das Ökokonto einen behördlich anerkannten naturschutzrechtlichen Grundstückszustand abbildet. Die Ökopunkte sind nicht frei handelbar, sondern können nur zusammen mit dem Grundstück übertragen werden. Folglich ist die Abfindung, soweit sie auf das Ökokonto entfällt, als Ausgleichsleistung für den Grundstückserwerb anzusehen. Hinweise: Der Streitfall betraf das Ökokonto in Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer haben ebenfalls Rechtsverordnungen zum Ökokonto erlassen. Sofern auch nach diesen Rechtsverordnungen das Ökokonto nicht getrennt vom Grundstück übertragen werden kann, dürfte das aktuelle Urteil auch für die Rechtsverordnungen anderer Bundesländer gelten, so dass es dort ebenfalls nicht zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage kommt.Quelle: BFH, Urteil vom 4.6.2025 – II R 47/22; NWB
