Aktuelles
-
Verlängerte Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute
Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zugestimmt. Das Gesetz wurde bereits im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit werden die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten auf zehn Jahre verlängert.Neben Regelungen zur Verbesserung der Bekämpfung von Schwarzarbeit enthält das Gesetz u.a. eine umsatzsteuerliche Regelung zur Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Grundstücken. Es wird klargestellt, dass die Vorsteueraufteilung für gemischt genutzte Grundstücke grundsätzlich nach dem Verhältnis der Nutzflächen vorzunehmen ist (sog. Flächenschlüssel), es sei denn, eine andere Methode führt zu einer sachlich präziseren Zuordnung. Ferner wurde eine Übergangsregelung zur sog. Umsatzsteuerlagerregelung eingeführt.Quelle: Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung, BGBl. 2025 I Nr. 369; NWB
-
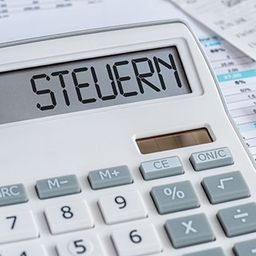
Aktivrente beschlossen
Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem sog. Aktivrentengesetz zugestimmt. Das Aktivrentengesetz wurde am 23.12.2025 im Bundesgesetzblatt verkündet, sodass es zum 1.1.2026 in Kraft getreten ist.Die Aktivrente erlaubt es Menschen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben, freiwillig im Ruhestand weiterzuarbeiten. Sie können dabei bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung müssen dagegen weiterhin gezahlt werden.Die Aktivrente gilt für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer ab Erreichen der Regelaltersgrenze (grundsätzlich Vollendung des 67. Lebensjahres, jedoch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Übergangsregelungen je nach Geburtsjahrgang). Dabei erfolgt die Begünstigung unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige eine Rente bezieht oder den Rentenbezug aufschiebt.Hinweis: Die Aktivrente gilt nicht für Selbständige, Land- und Forstwirte, Minijobs sowie Beamte.Quelle: Aktivrentengesetz, BGBl. 2025 I Nr. 361 vom 23.12.2025; hierzu auch Bundesregierung online (FAQ); NWB
-

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Dezember 2025
Das Bundesfinanzministerium hat die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Dezember 2025 bekannt gegeben. Die monatlich fortgeschriebene Übersicht 2025 können Sie auf der Homepage des BMF abrufen.Quelle: BMF, Schreiben v. 2.1.2026 – III C 3 – S 7329/00014/007/181 ; NWB
