Aktuelles
-

Steuerfreier Sanierungsgewinn bei Schuldenerlass zugunsten eines Mitunternehmers
Werden dem Gesellschafter einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft die Schulden erlassen, kann dies zu einem steuerfreien Sanierungsgewinn führen, wenn die gesetzlichen Sanierungsvoraussetzungen bei der Personengesellschaft erfüllt sind. Es genügt nicht, dass bei dem Gesellschafter die gesetzlichen Sanierungsvoraussetzungen vorliegen. Hintergrund: Der Gesetzgeber stellt Sanierungsgewinne steuerfrei, wenn das Unternehmen sanierungsbedürftig und sanierungsfähig ist, wenn eine Sanierungsabsicht der Gläubiger besteht und wenn die Maßnahme, die zum Sanierungsgewinn geführt hat, für die Sanierung geeignet ist. Allerdings gehen im Umfang der Steuerfreiheit die Verlustvorträge unter. Sachverhalt: An einer GmbH & Co. KG waren B zu 5 % und A zu 95 % sowie die Komplementär-GmbH zu 0 % beteiligt. Die GmbH & Co. KG unterhielt einen Pensionsbetrieb, den sie von B gepachtet hatte. B hatte neben dem Pensionsbetrieb auch das dazugehörige Betriebsgrundstück an die GmbH & Co. KG verpachtet, so dass der verpachtete Pensionsbetrieb einschließlich Grundstück zu seinem Sonderbetriebsvermögen gehörte. Zu seinem Sonderbetriebsvermögen gehörten auch Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse; die Sparkasse hatte ihre Forderungen gegen B mit Grundschulden auf dem Betriebsgrundstück gesichert. Da sich der Pensionsbetrieb in finanziellen Schwierigkeiten befand, verhandelte B mit der Sparkasse über einen Schuldenerlass. Die Sparkasse erklärte sich bereit, auf die Hälfte ihrer Forderungen gegen B zu verzichten, falls B eine Einmalzahlung in Höhe von 350.000 € leisten würde. B zahlte im Streitjahr 2013 an die Sparkasse 350.000 €; diesen Betrag finanzierte er mit zwei Darlehen der Volksbank. Aufgrund der Einmalzahlung des B verzichtete die Sparkasse im Jahr 2013 auf ca. 350.000 €, so dass B im Jahr 2013 einen Ertrag von ca. 350.000 € erzielte, den er als steuerfreien Sanierungsgewinn behandelte. Dem folgte das Finanzamt nicht. Entscheidung: Der BFH konnte nicht abschließend entscheiden, ob die Voraussetzungen eines steuerfreien Sanierungsgewinns erfüllt waren, und verwies die Sache an das Finanzgericht (FG) zur weiteren Aufklärung zurück: Bei einem Schuldenerlass gegenüber dem Gesellschafter einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) kommt es bezüglich der Steuerfreiheit eines Sanierungsgewinns darauf an, ob die gesetzlichen Sanierungsvoraussetzungen bei der Mitunternehmerschaft (GmbH & Co. KG) erfüllt sind. Es müssen die Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens der Mitunternehmerschaft, die Sanierungsabsicht der Gläubiger sowie die Sanierungseignung der Maßnahme, die zum Sanierungsgewinn geführt hat, für das Unternehmen der Mitunternehmerschaft bejaht werden. Es genügt hingegen nicht, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns nur in der Person des Mitunternehmers, d.h. in der Person des B, vorliegen. Im Streitfall waren die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens der GmbH & Co. KG sowie die Sanierungsabsicht der Sparkasse zu bejahen. Die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens der GmbH & Co. KG war zu bejahen, weil das Sonderbetriebsvermögen des B überschuldet war und weil die GmbH & Co. KG ohne den Schuldenerlass in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten wäre. Denn das von B verpachtete Betriebsgrundstück war durch Grundschulden zugunsten der Sparkasse gesichert, so dass die GmbH & Co. KG bei einer Vollstreckung der Sparkasse gegen B möglicherweise ihre Betriebsgrundlage verloren hätte. Auch die Sanierungsabsicht der Sparkasse war zu bejahen, weil für die Sparkasse die Sanierungsabsicht für den Schuldenerlass mitentscheidend gewesen ist. Dies ergab sich aus dem vorgelegten Schriftverkehr sowie aus einer Zeugenaussage eines Mitarbeiters der Sparkasse. Allerdings ließen sich die Sanierungsfähigkeit sowie die Sanierungseignung nicht feststellen. Dies muss nun das FG ermitteln. Hinweise: Für die Sanierungsfähigkeit und Sanierungseignung müsste feststehen, dass aufgrund des Schuldenerlasses der Sparkasse die Ertragsfähigkeit der GmbH & Co. KG hergestellt werden konnte. Dies war nach den bisherigen Sachverhaltsfeststellungen zweifelhaft; denn das Betriebsgrundstück mit der Pension bedurfte einer umfangreichen Sanierung. Es waren also wohl weitere finanzielle Mittel erforderlich, um das Pensionsgebäude zu sanieren. Hinzu kam, dass auf dem Nachbargrundstück der GmbH & Co. KG ein Konkurrent ebenfalls einen Übernachtungsbetrieb eröffnet hatte. Dies erschwerte die Ertragsfähigkeit der GmbH & Co. KG.Auch wenn es sich bei der Sanierungsfähigkeit und der Sanierungseignung formal gesehen um zwei unterschiedliche Sanierungsvoraussetzungen zu handeln scheint, werden beide Voraussetzungen faktisch zusammengeprüft. Dem BFH zufolge kann die Sanierungsfähigkeit daher bejaht werden, wenn der Schuldenerlass für die Sanierung geeignet ist. Quelle: BFH, Urteil vom 21.8.2025 – IV R 23/23; NWB
-

Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Erwerb von Oldtimern zur Wertanlage
Eine GmbH, die Immobilien vermietet, hat keinen Anspruch auf die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, wenn sie zwecks Wertanlage zwei Oldtimer anschafft und hält, selbst wenn sie mit den Oldtimern bislang keine Einnahmen erzielt hat. Ihr gesamter Gewinn unterliegt daher der Gewerbesteuer.Hintergrund: Unternehmen, die nur aufgrund ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft oder aufgrund ihrer gewerblichen Prägung als GmbH & Co. KG gewerbesteuerpflichtig sind, tatsächlich aber ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, können die sog. erweiterte Gewerbesteuerkürzung beantragen. Der Ertrag aus der Grundstücksverwaltung und -nutzung unterliegt dann nicht der Gewerbesteuer. Sachverhalt: Die Klägerin war eine GmbH und damit grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig. Sie nutzte und verwaltete in den Streitjahren 2016 bis 2020 eigene Immobilien. Außerdem hatte sie in den Jahren 2011 und 2012 zwei Oldtimer als Wertanlage mit Gewinnerzielungsabsicht erworben. Sie hielt diese beiden Oldtimer auch noch in den Streitjahren 2016 bis 2020 und hatte bis Ende 2020 noch keine Einnahmen mit den Oldtimern erzielt. Die Klägerin beantragte für die Jahre 2016 bis 2020 die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, die das Finanzamt wegen des Haltens der beiden Oldtimer ablehnte. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage ab: Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung wird nur gewährt, wenn die Immobiliengesellschaft ausschließlich eigenen Grundbesitz nutzt und verwaltet. Nach dem Gesetz besteht also ein Ausschließlichkeitsgebot. Nur in eingeschränktem Umfang sind noch weitere Tätigkeiten gewerbesteuerlich unschädlich; in den Streitjahren war dies noch das Nutzen und Verwalten eigenen Kapitalvermögens, wenn dies neben der Nutzung und Verwaltung eigenen Grundbesitzes erfolgt ist. Im Streitfall hat die Klägerin das Ausschließlichkeitsgebot verletzt. Denn sie hat neben der Nutzung und Verwaltung eigenen Grundbesitzes auch noch Wertanlagen in Gestalt der Oldtimer gehalten, um diese zu einem geeigneten Zeitpunkt mit Gewinn zu veräußern. Diese Tätigkeit ist nach dem Gesetz schädlich. Insbesondere handelte es sich nicht um die Nutzung und Verwaltung eigenen Kapitalvermögens, die nach dem Gesetz unschädlich ist, wenn sie neben der Grundstücksnutzung und -Verwaltung erfolgt; denn ein späterer Verkauf der Oldtimer hätte nicht zu Kapitaleinkünften geführt. Die Oldtimer dienten auch nicht der Nutzung und Verwaltung des eigenen Grundbesitzes. Anders wäre dies beim Erwerb von Büroausstattung gewesen, die für die Immobilienverwaltung verwendet worden wäre und nicht als Wertanlage gedient hätte. Unbeachtlich war, dass die Klägerin aus dem Halten der Oldtimer in den Streitjahren keine Einnahmen erzielt hat. Ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot liegt nämlich bereits dann vor, wenn eine schädliche Tätigkeit – wie das Halten von Oldtimern zur Wertanlage – ausgeübt wird. Auf die Erzielung von Einnahmen kommt es nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht an. Der Gesetzgeber wollte die erweiterte Kürzung nur denjenigen Immobiliengesellschaften gewähren, die sich auf die Nutzung und Verwaltung eigenen Grundbesitzes und daneben ggf. noch auf die Verwaltung und Nutzung eigenen Kapitalvermögens beschränken.Hinweise: Seit 2021, also nach den Streitjahren, sind durch den Gesetzgeber noch weitere Tätigkeiten unschädlich gestellt worden, z.B. der Verkauf von selbst produziertem Solarstrom an die Mieter. Hier hat der Gesetzgeber eine Entgeltgrenze eingeführt; die Einnahmen aus diesen neuen Tätigkeiten dürfen nicht höher sein als 5 % der Vermietungseinnahmen. Bei anderen schädlichen Tätigkeiten kommt es jedoch auf die Erzielung eines Entgelts nicht an. Bislang war dies streitig und ist nun vom BFH entschieden worden. Immobiliengesellschaften sollten sich daher auf die ausdrücklich erlaubten Tätigkeiten beschränken. Schädliche Tätigkeiten sollten ggf. durch Schwester-Gesellschaften ausgeübt werden. Ausnahmsweise sind Tätigkeiten dann gewerbesteuerlich unschädlich, wenn sie ein zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung darstellen. Diese Ausnahme war im Streitfall aber erkennbar nicht gegeben, weil es keinen Bezug zwischen der Wertanlage und der Grundstücksnutzung gab.Quelle: BFH, Urteil vom 24.7.2025 – III R 23/23; NWB
-
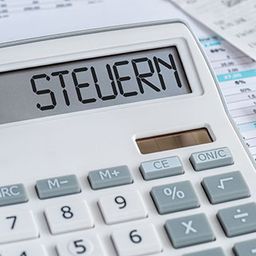
Grunderwerbsteuer: Grundstücksübertragung von Erbengemeinschaft auf Personengesellschaft
Eine Erbengemeinschaft, die ein Grundstück geerbt hat, kann dieses grunderwerbsteuerfrei auf eine Personengesellschaft übertragen, soweit die Miterben der Erbengemeinschaft an der Personengesellschaft, die das Grundstück nun erhält, beteiligt sind und auch in den nächsten zehn Jahren beteiligt bleiben. Hintergrund: Nach dem Gesetz ist der Erwerb eines zum Nachlass gehörenden Grundstücks durch einen Miterben zur Teilung des Nachlasses grunderwerbsteuerfrei. Grunderwerbsteuerfrei ist auch die Übertragung eines Grundstücks von einem Gesellschafter auf eine Personengesellschaft, soweit der Gesellschafter an der Personengesellschaft beteiligt ist und sich seine Beteiligung in den zehn Jahren nach dem Übergang des Grundstücks nicht mindert; nach der bis zum 1.7.2021 geltenden Rechtslage betrug die Frist fünf Jahre. Sachverhalt: A und seine fünf Geschwister waren zu je 1/6 Mitglieder einer Erbengemeinschaft nach ihrem verstorbenen Vater. Zum Vermögen der Erbengemeinschaft gehörten die drei Grundstücke 1, 2 und 3. Am 10.7.2014 gründeten die sechs Geschwister eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), an der sie zu jeweils 1/6 beteiligt waren. Mit notariellem Teil-Erbauseinandersetzungsvertrag vom selben Tage übertrugen die sechs Miterben die Grundstücke 2 und 3 unentgeltlich auf die GbR (Klägerin); nach dem Vertrag erfolgte die Übertragung zur teilweisen Teilung des Nachlasses im Wege der Auseinandersetzung. In einem weiteren Vertrag, ebenfalls vom selben Tag, erwarb die Klägerin das Grundstück 4 und übertrug es noch am selben Tag auf A; im Gegenzug wurde dessen Beteiligung an der GbR von 16,66 % auf 0,55 % gemindert. Das Finanzamt setzte für die Übertragung der Grundstücke 2 und 3 von der Erbengemeinschaft auf die GbR Grunderwerbsteuer fest, ließ den Vorgang aber im Umfang von 83,85 % steuerfrei, da in diesem Umfang dieselben Personen beteiligt waren und auch blieben (5 x 16,66 % + 0,55 %). Die GbR klagte hiergegen und machte eine vollständige Grunderwerbsteuerfreiheit geltend.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage der GbR ab: Die Übertragung der beiden Grundstücke 2 und 3 auf die Klägerin war grunderwerbsteuerbar, weil der Teil-Erbauseinandersetzungsvertrag einen Anspruch der Klägerin auf Übereignung der beiden Grundstücke begründete. Die Übertragung der beiden Grundstücke war grundsätzlich grunderwerbsteuerfrei, da sie zwecks Teilung des Nachlasses erfolgte. Zwar gehörten zum Nachlass insgesamt drei Grundstücke (1, 2 und 3), während der Teil-Erbauseinandersetzungsvertrag nur zwei Grundstücke betraf; steuerfrei ist aber auch der erste Schritt der Teilung des Nachlasses, so dass es unschädlich ist, dass die Erbengemeinschaft noch fortbestand, nämlich bezüglich des Grundstückes 1. Allerdings ist nach dem Gesetz nur der Erwerb durch einen oder mehrere Miterben steuerfrei, nicht aber der Erwerb durch eine Personengesellschaft, die selbst keine Miterbin ist. Insoweit greift jedoch der Rechtsgedanke der Steuerbefreiung, die für Grundstücksübertragungen von Gesellschaftern auf ihre Personengesellschaft und umgekehrt gilt und nach der im Umfang der Beteiligung die Grundstücksübertragung grunderwerbsteuerfrei ist. Daher ist die Übertragung eines Grundstücks von einer Erbengemeinschaft auf eine Personengesellschaft bei Teilung des Nachlasses insoweit steuerfrei, als die Miterben an der Personengesellschaft, die das Grundstück erwirbt, beteiligt sind. Dabei müssen aber auch die sog. Nachhaltefristen beachtet werden, die im Streitfall noch fünf Jahre betrugen; die Steuerbefreiung setzt im Streitfall also voraus, dass die Miterben an der erwerbenden Personengesellschaft noch fünf Jahre lang mit der Beteiligungsquote beteiligt bleiben müssen. Im Streitfall waren zwar alle sechs Miterben an der erwerbenden Klägerin beteiligt; jedoch minderte sich der Anteil des A an der Klägerin noch am 10.7.2014 von 16,66 % auf 0,55 %. Daher war die Steuerbefreiung nur im Umfang von 83,85 % (5 x 16,66 % + 0,55 %) zu gewähren. Hinweise: Im Ergebnis wendet der BFH die Steuerbefreiung für die Teilung eines Nachlasses nur dem Grunde nach an, weil Erwerber der Grundstücke nicht ein Miterbe, sondern eine GbR war, die selbst keine Miterbin war. Der Höhe nach ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Miterben an der GbR beteiligt sind und ob sie während der gesetzlichen Nachhaltefrist von aktuell zehn Jahren (im Streitfall waren es noch fünf Jahre) ihre Beteiligung gemindert haben. Grunderwerbsteuerfrei ist auch die Vererbung eines Grundstücks an nur einen einzigen Erben; insoweit entsteht lediglich Erbschaftsteuer. Gibt es aber mindestens zwei Erben, spricht man von Miterben. Teilen diese den Nachlass, so dass einer der Miterben das Grundstück erhält, soll dies ebenfalls – wie bei einem Alleinerben – grunderwerbsteuerfrei möglich sein. Quelle: BFH, Urteil vom 4.6.2025 – II R 42/21; NWB
