Aktuelles
-

Hinzuschätzung bei gravierenden formellen Buchführungsmängeln
Schwerwiegende formelle Buchführungsmängel rechtfertigen bei einem bargeldintensiven Betrieb eine Hinzuschätzung. Ein derartiger schwerwiegender Buchführungsmangel liegt vor, wenn im Kassensystem Stornierungen weder in den Kassenbelegen über den Tagesabschluss noch in den sog. Z-Bons (Tagesendsummenbons) ausgewiesen werden. Hintergrund: Bei der Bilanzierung sind zahlreiche formelle Buchführungsvorschriften zu beachten. Zum Streit mit dem Finanzamt kommt es häufig bei Betrieben, die einen Großteil ihrer Einnahmen bar erzielen (z.B. Restaurants, Taxiunternehmen) und deren Kassenbuchführung nicht ordnungsgemäß ist. Je nach Umfang und Gewicht der Buchführungsmängel kann das Finanzamt zu einer Schätzung des Gewinns und der Umsätze berechtigt sein. Es stellt sich dann die Frage, welche Schätzungsmethode rechtmäßig ist. Sachverhalt: Der Kläger war Gastwirt und ermittelte seinen Gewinn durch Bilanzierung. In den Streitjahren 2011 bis 2013 erstellte seine EDV-Kasse sog. Tagesabschlüsse, in denen systembedingt keine Stornobuchungen aufgeführt waren. Außerdem waren die Tagesabschlüsse nicht fortlaufend nummeriert und enthielten weder Angaben zur Zahlungsweise noch zur Uhrzeit, zu der der jeweilige Tagesabschluss erstellt wurde. Der Kläger konnte dem Außenprüfer auch keine Programmier- und Bedienungsanleitungen für die Kasse vorlegen. Das Finanzamt verwarf die Buchführung als nicht ordnungsgemäß und schätzte den Gewinn und die Umsätze. Dabei orientierte sich der Außenprüfer an der Richtsatzsammlung der Finanzverwaltung, die die Rohgewinnaufschlagsätze branchenspezifisch erfasst, nahm den niedrigsten Rohgewinnaufschlag von 186 % an und minderte diesen Aufschlag um einen zusätzlichen Sicherheitsabschlag von 30 %; dies führte zu einer Erhöhung der Erlöse und Umsätze pro Streitjahr zwischen ca. 10 % und 16 %. Das Finanzgericht (FG) in der ersten Instanz folgte dieser Vorgehensweise. Entscheidung: Der BFH bejahte zwar eine Schätzungsbefugnis des Finanzamts, verwies die Sache aber zur Überprüfung der Höhe der Schätzung an das FG zurück: Das Finanzamt war zu einer Schätzung berechtigt, da die Buchführung des Klägers erhebliche formelle Buchführungsmängel aufwies und daher zu verwerfen war. Ein besonders schwerwiegender Buchführungsmangel war, dass das Kassensystem keine Stornierungen auswies, so dass weder in den Belegen über die Tagesabschlüsse noch in den sog. Z-Bons (Tagesendsummenbons) Stornierungen ersichtlich waren. Damit war nicht feststellbar, ob der Kläger lediglich Fehlbuchungen korrigierte oder aber zutreffende Einnahmebuchungen löschte. Da der Kläger als Gastwirt einen bargeldintensiven Betrieb unterhielt, bestand folglich keine Gewähr mehr für die Vollständigkeit der Erfassung der Bareinnahmen, so dass eine (Hinzu-)Schätzung dem Grunde nach gerechtfertigt war. Das Finanzamt musste nicht nachweisen, dass das Kassensystem tatsächlich manipuliert wurde. Die Schätzung war jedoch der Höhe nach fehlerhaft. Zwar hat das Finanzamt grundsätzlich die Wahl zwischen mehreren Schätzungsmethoden. Es muss bei mehreren Schätzungsmethoden aber diejenige Methode vorrangig wählen, die dem tatsächlich erzielten Gewinn und Umsatz am Nächsten kommt, und seine Schätzung auch begründen. Beides ist im Streitfall nicht geschehen. Vorrangig wäre ein innerer Betriebsvergleich gewesen, weil sich dieser an den Verhältnissen des Betriebs orientiert. Sofern die Buchführungsunterlagen der Streitjahre hierfür nicht verwertbar gewesen sein sollten, hätte das Finanzamt die Zahlen der Folgejahre ab 2014 heranziehen und diese ggf. mindern können, um etwaige Preissteigerungen ab 2014 zu berücksichtigen. Die Richtsatzsammlung ist hingegen grundsätzlich weniger geeignet, da die Richtsätze auf den Zahlen anderer Betriebe beruhen. Zudem ist es widersprüchlich, einen Wert der Richtsatzsammlung heranzuziehen und diesen dann um einen Sicherheitsabschlag von 30 % zu mindern. Es handelt sich dann nämlich nicht mehr um eine Richtsatzschätzung, sondern um eine sog. griffweise Schätzung. Bei dieser ist dann – mangels Begründung – nicht verständlich, weshalb nicht ein Sicherheitsabschlag von 40 % oder 20 % angebracht gewesen wäre. Hinweise: Das Finanzgericht muss nun die Schätzung des Finanzamts erneut überprüfen und ermitteln, ob ein innerer Betriebsvergleich – ggf. auf der Grundlage der Zahlen der Folgejahre, die wegen möglicher Preissteigerungen zu korrigieren wären – möglich ist. Von Bedeutung könnte auch sein, dass der Kläger ab 2016 eine sog. fiskalisierte Kasse verwendete, die als manipulationssicher gilt, und dass der Kläger ab 2016 keine höheren Gewinne und Umsätze als in den Streitjahren erzielt hat. Im Übrigen wiederholt der BFH seine Zweifel an der Tauglichkeit der Richtssatzsammlung für Hinzuschätzungen, die er bereits jüngst in einer anderen Entscheidung geäußert hat. Dem BFH fehlt u.a. die Transparenz, um die in der Richtsatzsammlung genannten Werte nachvollziehen zu können. Sollte im weiteren Verlauf des Verfahrens sowohl ein innerer Betriebsvergleich als auch eine Schätzung auf der Grundlage der Richtsatzsammlung ausscheiden, käme nur ein Sicherheitszuschlag im Wege einer sog. griffweisen Schätzung in Betracht. Quelle: BFH, Urteil vom 29.7.2025 – X R 23-24/21; NWB
-
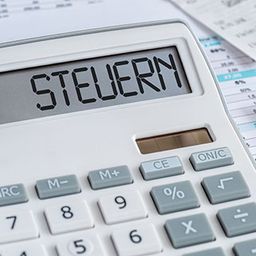
Grundsteuerreform laut Bundesfinanzhof verfassungskonform
Der Bundesfinanzhof (BFH) hält die Grundsteuerreform für verfassungskonform, soweit es sich um das sog. Bundesmodell handelt, das in allen Bundesländern außer Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen gilt. Hintergrund: Die Grundsteuer ist zum 1.1.2025 reformiert worden. Zu diesem Zweck mussten alle Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Die Neubewertung soll sich an den aktuellen Verkehrswerten orientieren, so dass es in vielen Fällen zu höheren Grundsteuerwerten kommen wird.Sachverhalte: Der BFH musste über drei Klagen von Wohnungseigentümern aus Köln, Sachsen und Berlin entscheiden. In Köln wurde eine 54 qm große vermietete Eigentumswohnung im Souterrain eines vor 1949 errichteten Mietwohnhauses, das sich in guter Wohnlage befand, neu bewertet. In Sachsen ging es um eine selbst genutzte Eigentumswohnung, die 70 qm groß war, sich in einer sächsischen Gemeinde befand und im Jahr 1995 fertiggestellt worden war. Im Berliner Fall handelte es sich um eine vermietete Wohnung mit einer Größe von 58 qm, die sich in einem vor 1949 erbauten Mehrfamilienhaus in einfacher Wohngegend befand. In allen drei Fällen wurden Grundsteuerwerte im sog. Ertragswertverfahren festgestellt, gegen die sich die Kläger mit der Begründung wandten, dass die Grundsteuerreform verfassungswidrig sei und zu überhöhten Werten führe.Entscheidungen: Der Bundesfinanzhof (BFH) bejahte die Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuerreform: Das Ertragswertverfahren, das bei Wohnungen angewendet wird, verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz. Der Gesetzgeber darf Regelungen treffen, die generalisierend, pauschal und typisierend sind. Die Grundsteuerreform ist darauf angelegt, im Durchschnitt den objektiv-realen Grundstückswert festzustellen. Soweit beim Ertragswertverfahren ein Bodenrichtwert für den Wert des Grund und Bodens angesetzt wird und eine Abweichung vom Bodenrichtwert im Umfang von 30 % nach oben oder nach unten erlaubt ist, ist dies nicht zu beanstanden. Die Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen aus tatsächlich vereinbarten Kaufpreisen abgeleitet. Auch der Ansatz pauschalierter Nettokaltmieten ist verfassungsgemäß. Zwar unterscheiden die pauschalierten Nettokaltmieten nur nach der Gebäudeart, nach dem Baujahr, nach der Wohnfläche und nach dem Bundesland; innerhalb des Bundeslands findet eine Differenzierung nur nach sog. Mietniveaustufen statt, die pro Gemeinde bzw. Stadt festgelegt werden. Damit erfolgt keine Differenzierung nach Stadtteilen – auch nicht in Großstädten –, obwohl es zwischen den einzelnen Stadtteilen erhebliche Mietunterschiede gibt. Dies ist für Immobilien in guten Lagen erfreulich, nicht aber für Immobilien in schlechten Lagen, da die pauschalierte Nettokaltmiete höher sein kann als die tatsächlich erzielbare Miete.Die damit verbundene Ungleichbehandlung ist aber durch die Vereinfachung im sog. Massenverfahren gerechtfertigt. Würde man auf die tatsächliche Miete abstellen, wäre dies ein erheblicher Verwaltungsaufwand angesichts einer Zahl von ca. 36 Millionen Grundstücken. Außerdem erfolgt eine Korrektur über den Bodenrichtwert, der in den einzelnen Wohngegenden von Großstädten unterschiedlich ausfällt. In dem Verfahren aus Sachsen hatte die Klage aus rein verfahrensrechtlichen Gründen teilweise Erfolg. Hinweise: Steuerpflichtige haben die Möglichkeit, einen niedrigeren gemeinen Wert als den vom Finanzamt festgestellten Grundsteuerwert nachzuweisen. Sie müssen dann mit Hilfe eines Sachverständigengutachtens nachweisen, dass der vom Finanzamt festgestellte Grundsteuerwert den gemeinen Wert um mindestens 40 % übersteigt. Die drei Urteile betreffen das sog. Bundesmodell, das in Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen gilt. Die Urteile gelten nicht für die Grundsteuermodelle in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Bei den Verfahren handelt es sich um Musterklagen, die vom Bund der Steuerzahler sowie von Haus & Grund Deutschland unterstützt werden. Beide Verbände haben bereits angekündigt, dass die Kläger gegen die Urteile Verfassungsbeschwerde einlegen werden. Nur das Bundesverfassungsgericht kann die Verfassungswidrigkeit einer Norm feststellen. Quelle: BFH, Urteile vom 12.11.2025 – II R 25/24, II R 31/24 und II R 3/25; NWB
-

Aufteilung eines Kaufpreises für eine denkmalgeschützte Immobilie
Der Kaufpreis für eine denkmalgeschützte Immobilie, die vermietet wird, ist auf den nicht abschreibbaren Grund und Boden sowie auf das abschreibbare Gebäude aufzuteilen. Der Denkmalschutz für das Gebäude führt nicht zu einer unendlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes, so dass der Kaufpreis allein dem Gebäude zuzurechnen wäre. Hintergrund: Grundsätzlich ist ein Kaufpreis, der für eine Immobilie gezahlt wird, aufzuteilen, und zwar auf den Grund und Boden, der nicht abgeschrieben werden kann, sowie auf das Gebäude, das abgeschrieben werden kann. Wie die Aufteilung erfolgen soll, ist in der Praxis häufig streitig: Eine Aufteilung im Kaufvertrag wird von der Rechtsprechung nur akzeptiert, wenn sie wirtschaftlich nachvollziehbar ist und der Wert für den Grund und Boden nicht wesentlich von den Bodenrichtwerten abweicht. Demgegenüber hat die Finanzverwaltung eine sog. Arbeitshilfe veröffentlicht, die jedoch meist zu sehr niedrigen Gebäudeanteilen führt, so dass die Abschreibung entsprechend gering ausfällt. Sachverhalt: Die Kläger erwarben im Jahr 2003 ein vermietetes Grundstück, welches mit einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem 17. Jahrhundert bebaut war und das die Kläger vermieteten. Der Kaufpreis für das Grundstück betrug ca. 800.000 €, und die Anschaffungsnebenkosten beliefen sich auf ca. 40.000 €. Die Kläger waren der Auffassung, dass das Gebäude aufgrund des Denkmalschutzes unendlich lange nutzbar sei, da es permanent instandgehalten werden müsse. Dem widersprach das Finanzamt. In der ersten Instanz holte das Finanzgericht (FG) ein Sachverständigengutachten ein. Der Sachverständige ermittelte einen Gebäudeanteil von 41,1 % sowie eine Restnutzungsdauer von 30 Jahren. Dabei wandte er das sog. allgemeine Ertragswertverfahren an. Das FG folgte dem Sachverständigengutachten, ermittelte die Abschreibung aber auf der Grundlage einer Restnutzungsdauer von 40 Jahren.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage nur in geringem Umfang statt: Die Kaufpreisaufteilung auf der Grundlage des Sachverständigengutachtens, die zu einem Gebäudeanteil von 41,1 % geführt hat, war nicht zu beanstanden. Denn der Sachverständige hat mit dem allgemeinen Ertragswertverfahren ein geeignetes Aufteilungsverfahren angewendet und die Einzelheiten des Sachverhalts berücksichtigt. So hat der Sachverständige etwa auch die Denkmaleigenschaft des Gebäudes und dabei das Alter und den Zustand des Gebäudes sowie die bereits durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen berücksichtigt. Der Sachverständige hat dabei zu Recht eine unbegrenzte Nutzungsdauer des Gebäudes abgelehnt, die zu einem Grund- und Bodenwert von 0 € geführt hätte; denn der Denkmalschutz für das Gebäude mindert allenfalls den Wert des Gebäudes, nicht aber den Wert des Grund und Bodens. Zu Unrecht hat das FG jedoch eine Abschreibung nur auf der Basis einer Restnutzungsdauer von 40 Jahren (also 2,5 % jährlich) statt auf der Grundlage einer Restnutzungsdauer von 30 Jahren (3,33 % jährlich) berücksichtigt. Aus dem Sachverständigengutachten ergab sich nämlich eine Restnutzungsdauer von lediglich 30 Jahren, so dass die Abschreibung 3,33 % jährlich beträgt. Hinweise: Zwar wird ein denkmalgeschütztes Gebäude höhere Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen auslösen als ein reguläres Gebäude; dies führt allerdings nicht zu einem höheren Gebäudewert, wie das aktuelle Urteil zeigt. Die Kläger können dafür jedoch die höheren Aufwendungen steuerlich geltend machen. Zudem sind bei Baudenkmälern erhöhte Abschreibungen gesetzlich zugelassen, die bis zu 9 % jährlich betragen.Das Bundesfinanzministerium hat jüngst einen Entwurf für eine Kaufpreisaufteilung vorgelegt, der im Wege der Rechtsverordnung in Kraft gesetzt werden sollte. Allerdings ist die Bundesregierung diesem Entwurf nicht gefolgt und hat die vorgeschlagene Neuregelung wieder aus dem Entwurf herausgenommen. Quelle: BFH, Urteil vom 7.10.2025 – IX R 26/24; NWB
