Aktuelles
-
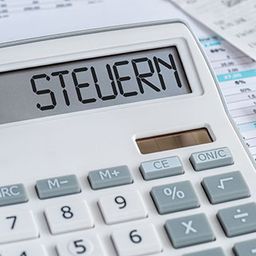
Schenkungsteuer bei Zuwendungen an eine Landesstiftung
Freigebige Zuwendungen an eine Stiftung eines Bundeslandes sind grundsätzlich schenkungsteuerpflichtig. Eine Schenkungsteuerfreiheit ist nur dann anzunehmen, wenn die Zuwendung entweder ausschließlich Zwecken der jeweiligen Gebietskörperschaft (Bund, Land oder Gemeinde) dient oder wenn die Zwecke der Satzung der Stiftung ausschließlich steuerbegünstigte Zwecke sind. Hintergrund: Der Schenkungsteuer unterliegt eine Zuwendung, die freigebig ist und durch die der Beschenkte auf Kosten des Schenkers bereichert wird. Von der Schenkungsteuerpflicht befreit sind u.a. Zuwendungen an den Bund, ein Land oder eine inländische Gemeinde (Gemeindeverband) sowie solche Zuwendungen, die ausschließlich Zwecken des Bundes, eines Landes oder einer inländischen Gemeinde (Gemeindeverband) dienen; der Gesetzgeber bezeichnet derartige Zuwendungen als „Anfälle“. Ferner sind Zuwendungen schenkungsteuerfrei, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem bestimmten Zweck gesichert ist.Sachverhalt: Die Klägerin war eine rechtsfähige Stiftung, die nicht als gemeinnützig anerkannt war und die durch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gegründet wurde. Die Klägerin verfolgte nach ihrer Satzung insbesondere den Schutz des Klimas, der Umwelt, der Gewässer und des Trinkwassers. Die Klägerin beteiligte sich an einem Bauprojekt, das sie zusammen mit der X-AG durchführen wollte. Die Klägerin stellte ihre Leistungen der X-AG in Rechnung, die die Rechnungen der Klägerin bezahlte. Darüber hinaus zahlte die X-AG noch zwei Beträge an die Klägerin im Jahr 2021, für die die Klägerin keine Rechnungen ausgestellt hatte. Das Finanzamt sah in diesen beiden Zahlungen schenkungsteuerpflichtige Zuwendungen und erließ gegenüber der Klägerin zwei Schenkungsteuerbescheide. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage ab: Bei den beiden zusätzlichen Zahlungen der X-AG handelte es sich um freigebige Zuwendungen, die der Schenkungsteuerpflicht unterlagen. Denn für die beiden Zahlungen musste die Klägerin keine Gegenleistung erbringen. Soweit die Klägerin Leistungen an die X-AG im Rahmen des Bauprojekts erbracht hatte, hatte die Klägerin Rechnungen ausgestellt, die die X-AG bezahlte. Für die beiden Zahlungsbeträge musste die Klägerin jedoch keine Leistungen erbringen und hat dementsprechend auch keine Rechnungen an die X-AG ausgestellt. Die Zuwendungen waren nicht steuerfrei. Soweit der Gesetzgeber Zuwendungen steuerfrei stellt, die ausschließlich Zwecken des Bundes, eines Bundeslandes oder einer inländischen Gemeinde bzw. eines Gemeindeverbands dienen, lagen die Voraussetzungen nicht vor. Die X-AG als Zuwenderin hat nämlich nicht festgelegt, dass ihre beiden Zahlungen ausschließlich Zwecken des Landes Mecklenburg-Vorpommern dienen. Zwar könnte sich die X-AG die Zwecke in der Satzung der Klägerin zu eigen gemacht haben; die Klägerin verfolgt nach ihrer Satzung aber nicht ausschließlich Zwecke des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die in der Satzung genannten Zwecke lediglich „insbesondere“ verfolgt werden sollten. Es ist daher denkbar, dass die Klägerin noch weitere Zwecke verfolgt hat, die nicht ausdrücklich genannt waren und nicht Zwecke des Landes Mecklenburg-Vorpommern waren. Auch die Steuerfreiheit für Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem bestimmten Zweck gesichert ist, war nicht anwendbar. Es fehlte bereits an einer Widmung der Zuwendungen durch die X-AG. Zudem verfolgte die Klägerin in ihrer Satzung nur „insbesondere“ die Zwecke des Umweltschutzes und des Trinkwasserschutzes sowie vergleichbare Zwecke. Daher war es möglich, dass die Klägerin die Zuwendungen für nicht steuerbegünstigte Zwecke verwendet. Hinweise: Die Einschaltung einer Landesstiftung könnte haushaltsrechtliche Gründe gehabt haben. Eine Stiftung wird von der öffentlichen Hand häufig deshalb errichtet, um private Gelder für die jeweilige öffentliche Aufgabe einzuwerben. Das Risiko besteht nach dem aktuellen Urteil aber darin, dass die privaten Gelder eine Schenkungsteuerpflicht auslösen. Steuerlich sinnvoller wäre es gewesen, wenn die Zahlungen an einen als gemeinnützig anerkannten Verein geleistet worden wären. Quelle: BFH, Urteil vom 30.7.2025 – II R 12/24; NWB
-

Keine Tarifermäßigung für Corona-Hilfen im Jahr des Einnahmeausfalls
Ein Unternehmer, der im Jahr 2020 Corona-Hilfen für Einnahmeausfälle des Jahres 2020 gewinnerhöhend erfasst hat, erhält keine Tarifermäßigung für die Corona-Hilfen. Für eine Tarifermäßigung fehlt es an der erforderlichen Zusammenballung von Einkünften im Jahr 2020.Hintergrund: Für außerordentliche Einkünfte gewährt der Gesetzgeber eine sog. Tarifermäßigung, durch die der Steuersatz gemindert wird. Zu den außerordentlichen Einkünften gehören u.a. Entschädigungen für entgangene oder entgehende Einnahmen und Entschädigungen für die Nichtausübung einer Tätigkeit. Die Tarifermäßigung setzt voraus, dass es aufgrund der außerordentlichen Einkünfte zu einer sog. Zusammenballung von Einkünften und damit zunächst zu einer Erhöhung des Steuersatzes gekommen ist.Sachverhalt: Der Kläger war Schausteller und ermittelte seinen Gewinn durch Bilanzierung. Aufgrund der Corona-Krise sanken seine Betriebseinnahmen im Jahr 2020 von ca. 480.000 € in den Vorjahren auf 130.000 €. Dem Kläger wurden im Jahr 2020 Corona-Hilfen in Höhe von ca. 150.000 € gewährt, die er gewinnerhöhend erfasste. Seine Betriebsausgaben betrugen im Jahr 2020 ca. 170.000 €, so dass sich sein Gewinn für 2020 auf ca. 110.000 € belief. In den Vorjahren hatte der Kläger Betriebsausgaben in Höhe von etwa 400.000 € jährlich getätigt. Der Kläger beantragte für 2020 die Tarifermäßigung für die Corona-Hilfen. Das Finanzgericht wies die Klage ab, und der Kläger legte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein.Entscheidung: Der BFH wies die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision als unbegründet zurück: Zwar hat der Kläger im Streitjahr 2020 außerordentliche Einkünfte erzielt. Die Corona-Hilfen stellten nämlich Entschädigungen für entgangene Einnahmen bzw. für die Nichtausübung einer Tätigkeit dar. Es fehlte jedoch an einer Zusammenballung von Einkünften. Denn die Betriebseinnahmen des Jahres 2020 betrugen lediglich rund 280.000 € (Einnahmen aus dem Schaustellergeschäft zuzüglich Corona-Hilfen) und waren damit niedriger als in den Vorjahren, in denen er jeweils ca. 480.000 € erzielt hatte. Zwar betrug der Gewinn im Jahr 2020 ca. 110.000 € und war damit höher als in den Vorjahren, als er sich durchschnittlich nur auf etwa 80.000 € belief. Der höhere Gewinn im Jahr 2020 beruhte jedoch nicht auf einer Zusammenballung von Einkünften bzw. Einnahmen, sondern auf einer Minderung der Betriebsausgaben. Zu einer Zusammenballung wäre es nur dann gekommen, wenn der Kläger im Streitjahr 2020 noch Einnahmen erzielt hätte, die normalerweise in anderen Jahren angefallen wären. Die im Jahr 2020 gewährten Corona-Hilfen betrafen aber das Jahr 2020. Hinweise: Eine Entschädigung für entgangene Einnahmen führt dann zu einer Zusammenballung von Einkünften und damit zu einem höheren Steuersatz, wenn die Entschädigung nicht in dem Jahr gezahlt wird, in dem die entgangenen Einnahmen an sich erzielt worden wären, sondern in einem vorherigen Jahr, in dem die Einnahmen noch fließen. Beispiel: A erzielt jährlich 50.000 € aus der Vermietung eines Gebäudes an einen Unternehmer; der Mietvertrag endet am 31.12.2030. Im Jahr 2025 vereinbart A mit dem Unternehmer, dass dieser den Mietvertrag zum 31.12.2025 beenden kann. Hierfür zahlt der Unternehmer dem A im Jahr 2025 eine Entschädigung von 200.000 €. Bei A kommt es nun im Jahr 2025 zu einer Zusammenballung von Einkünften, weil er neben der regulären Miete in Höhe von 50.000 € zusätzlich noch eine Entschädigung von 200.000 € im Jahr 2025 versteuern muss und damit einem höheren Steuersatz unterliegt. Im Streitfall führte die Gewährung von Corona-Hilfen sowie die Minderung der Betriebsausgaben nur zu einer Schwankung der Gewinnhöhe. Der Fall war also nicht anders zu beurteilen, als wenn der Kläger aus der normalen betrieblichen Tätigkeit als Schausteller einen ungewöhnlich hohen Gewinn im Jahr 2020 erzielt hätte. Eine solche Schwankung ist bei gewerblichen Einkünften aber nicht „außergewöhnlich“ und rechtfertigt daher keine Tarifermäßigung.Quelle: BFH, Beschluss vom 28.11.2025 – X B 27/25; NWB
-
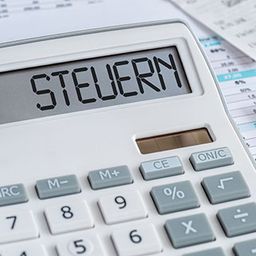
Verlängerung der steuerlichen Erleichterungen zur Unterstützung der Ukraine
Das Bundesfinanzministerium (BMF) verlängert seine steuerlichen Erleichterungen und Billigkeitsmaßnahmen, die es im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erlassen hat, bis zum 31.12.2026. Bislang waren die steuerlichen Erleichterungen bis zum 31.12.2025 befristet. Hintergrund: Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind viele Ukrainer nach Deutschland geflohen und werden hier durch Sach- oder Geldleistungen oder bei der Anmietung von Wohnungen unterstützt. Das BMF hat im Jahr 2022 mehrere Schreiben veröffentlicht, die steuerliche Erleichterungen für deutsche Unternehmer, Arbeitnehmer oder Wohnungsunternehmer beinhalten. Diese Erleichterungen waren ursprünglich bis zum 31.12.2022 befristet, wurden dann jährlich um jeweils ein Jahr verlängert, zuletzt bis zum 31.12.2025.Wesentliche steuerliche Erleichterungen: Die wichtigsten steuerlichen Erleichterungen, die nun bis zum 31.12.2026 weitergelten, betreffen folgende Bereiche:1. Spenden und Gemeinnützigkeitsrecht Gemeinnützige Vereine, die nicht mildtätige Zwecke fördern wie z.B. Sportvereine, dürfen Spendenaktionen zugunsten der Ukrainer durchführen und die Spenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge verwenden oder auf Sonderkonten mildtätiger Vereine oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts weiterleiten. Eine Satzungsänderung des Sportvereins ist also nicht erforderlich. Außerdem können gemeinnützige Vereine Sachmittel und Personal für ukrainische Kriegsflüchtlinge einsetzen. Die Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge muss nicht nachgewiesen werden. 2. Unterstützungsmaßnahmen von Unternehmen Unterstützungsleistungen von Unternehmen können als Betriebsausgaben in voller Höhe abgezogen werden. Der Abzug ist als Sponsoringaufwand möglich, wenn das Unternehmen auf seine Unterstützung öffentlichkeitswirksam in den Medien aufmerksam macht. 3. Arbeitslohnspenden und Aufsichtsratsspenden Arbeitslohnspenden sind steuerfrei. Der Arbeitnehmer kann also auf einen Teil seines Lohns verzichten, damit der Arbeitgeber diesen Teil zugunsten von Arbeitnehmern einsetzt, die vom Krieg geschädigt sind, oder damit der Arbeitgeber diesen Teil auf ein Ukraine-Sonderkonto einzahlt. Hinweis: Neben der Steuerfreiheit ist ein gleichzeitiger Spendenabzug nicht zulässig. 4. Umsatzsteuer Unterstützungsleistungen zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge lösen keine nachteiligen umsatzsteuerlichen Folgen aus. Die Bereitstellung von Sachmitteln oder Personal für humanitäre Zwecke wird also nicht als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer unterworfen. Ebenso unterbleibt eine Vorsteuerberichtigung zulasten des Unternehmers, wenn er Wohnraum unentgeltlich Kriegsflüchtlingen überlässt.5. Körperschaftsteuerbefreiung für Vermietungsgenossenschaft Zwar setzt die Körperschaftsteuerbefreiung für Vermietungsgenossenschaften nach dem Gesetz voraus, dass die Einnahmen der Genossenschaft aus den sonstigen Tätigkeiten wie z.B. der Vermietung von Wohnungen an Nicht-Mitglieder 10 % der gesamten Einnahmen nicht übersteigen. In die 10 %-Grenze gehen dem zufolge BMF aber Einnahmen aus der Vermietung an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die keine Mitglieder der Genossenschaft sind, aus Billigkeitsgründen nicht ein. Daher kann die Vermietung an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die keine Genossenschaftsmitglieder sind, nicht zu einer Überschreitung der 10 %-Grenze führen und damit auch nicht die Körperschaftsteuerfreiheit gefährden. Hinweis: Die vorstehend genannten steuerlichen Erleichterungen ergeben sich zwar nicht aus dem Gesetz, sondern nur aufgrund der steuerlichen Erleichterungen, die das BMF gewährt. Da die Finanzämter an die Schreiben des BMF gebunden sind, ist davon auszugehen, dass die Finanzämter die steuerlichen Erleichterungen gewähren werden. Quelle: BMF-Schreiben vom 4.12.2025 – IV D 5 – S 2223/00044/030/052 und vom 5.12.2025 – IV C 2 – S 1900/01934/009/023; NWB
