Aktuelles
-
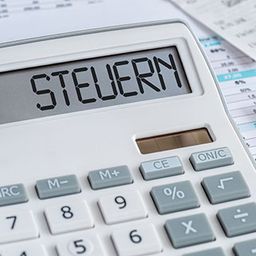
Verlängerung der steuerlichen Erleichterungen zur Unterstützung der Ukraine
Das Bundesfinanzministerium (BMF) verlängert seine steuerlichen Erleichterungen und Billigkeitsmaßnahmen, die es im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erlassen hat, bis zum 31.12.2026. Bislang waren die steuerlichen Erleichterungen bis zum 31.12.2025 befristet. Hintergrund: Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind viele Ukrainer nach Deutschland geflohen und werden hier durch Sach- oder Geldleistungen oder bei der Anmietung von Wohnungen unterstützt. Das BMF hat im Jahr 2022 mehrere Schreiben veröffentlicht, die steuerliche Erleichterungen für deutsche Unternehmer, Arbeitnehmer oder Wohnungsunternehmer beinhalten. Diese Erleichterungen waren ursprünglich bis zum 31.12.2022 befristet, wurden dann jährlich um jeweils ein Jahr verlängert, zuletzt bis zum 31.12.2025.Wesentliche steuerliche Erleichterungen: Die wichtigsten steuerlichen Erleichterungen, die nun bis zum 31.12.2026 weitergelten, betreffen folgende Bereiche:1. Spenden und Gemeinnützigkeitsrecht Gemeinnützige Vereine, die nicht mildtätige Zwecke fördern wie z.B. Sportvereine, dürfen Spendenaktionen zugunsten der Ukrainer durchführen und die Spenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge verwenden oder auf Sonderkonten mildtätiger Vereine oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts weiterleiten. Eine Satzungsänderung des Sportvereins ist also nicht erforderlich. Außerdem können gemeinnützige Vereine Sachmittel und Personal für ukrainische Kriegsflüchtlinge einsetzen. Die Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge muss nicht nachgewiesen werden. 2. Unterstützungsmaßnahmen von Unternehmen Unterstützungsleistungen von Unternehmen können als Betriebsausgaben in voller Höhe abgezogen werden. Der Abzug ist als Sponsoringaufwand möglich, wenn das Unternehmen auf seine Unterstützung öffentlichkeitswirksam in den Medien aufmerksam macht. 3. Arbeitslohnspenden und Aufsichtsratsspenden Arbeitslohnspenden sind steuerfrei. Der Arbeitnehmer kann also auf einen Teil seines Lohns verzichten, damit der Arbeitgeber diesen Teil zugunsten von Arbeitnehmern einsetzt, die vom Krieg geschädigt sind, oder damit der Arbeitgeber diesen Teil auf ein Ukraine-Sonderkonto einzahlt. Hinweis: Neben der Steuerfreiheit ist ein gleichzeitiger Spendenabzug nicht zulässig. 4. Umsatzsteuer Unterstützungsleistungen zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge lösen keine nachteiligen umsatzsteuerlichen Folgen aus. Die Bereitstellung von Sachmitteln oder Personal für humanitäre Zwecke wird also nicht als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer unterworfen. Ebenso unterbleibt eine Vorsteuerberichtigung zulasten des Unternehmers, wenn er Wohnraum unentgeltlich Kriegsflüchtlingen überlässt.5. Körperschaftsteuerbefreiung für Vermietungsgenossenschaft Zwar setzt die Körperschaftsteuerbefreiung für Vermietungsgenossenschaften nach dem Gesetz voraus, dass die Einnahmen der Genossenschaft aus den sonstigen Tätigkeiten wie z.B. der Vermietung von Wohnungen an Nicht-Mitglieder 10 % der gesamten Einnahmen nicht übersteigen. In die 10 %-Grenze gehen dem zufolge BMF aber Einnahmen aus der Vermietung an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die keine Mitglieder der Genossenschaft sind, aus Billigkeitsgründen nicht ein. Daher kann die Vermietung an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die keine Genossenschaftsmitglieder sind, nicht zu einer Überschreitung der 10 %-Grenze führen und damit auch nicht die Körperschaftsteuerfreiheit gefährden. Hinweis: Die vorstehend genannten steuerlichen Erleichterungen ergeben sich zwar nicht aus dem Gesetz, sondern nur aufgrund der steuerlichen Erleichterungen, die das BMF gewährt. Da die Finanzämter an die Schreiben des BMF gebunden sind, ist davon auszugehen, dass die Finanzämter die steuerlichen Erleichterungen gewähren werden. Quelle: BMF-Schreiben vom 4.12.2025 – IV D 5 – S 2223/00044/030/052 und vom 5.12.2025 – IV C 2 – S 1900/01934/009/023; NWB
-

Abfindung einer Pensionszusage eines beherrschenden GmbH-Gesellschafters
Verzichtet ein beherrschender GmbH-Gesellschafter auf seinen Anspruch aus einer ihm erteilten Pensionszusage vor Eintritt des Versorgungsfalls, führt dies nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung bei ihm, wenn der Verzicht aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der GmbH und damit aus betrieblichen Gründen erfolgt ist.Hintergrund: Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt bei einer Vermögensminderung oder auch verhinderten Vermögensmehrung einer Kapitalgesellschaft vor, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und nicht zu einer offenen Gewinnausschüttung gehört. Die verdeckte Gewinnausschüttung erhöht das Einkommen der Kapitalgesellschaft und wird beim Gesellschafter als Kapitaleinnahme versteuert. Ein typisches Beispiel für eine verdeckte Gewinnausschüttung ist ein überhöhtes Gehalt für den Gesellschafter-Geschäftsführer oder die Gewährung eines zinslosen Darlehens an den Gesellschafter. Sachverhalt: Der Kläger war mit 90 % an der A-GmbH beteiligt. Die A-GmbH erteilte ihm im Jahr 2002 eine Pensionszusage, die mit Vollendung des 65. Lebensjahres ausgezahlt werden sollte; bei Erteilung der Pensionszusage war der Kläger 55 Jahre alt. Die A-GmbH schloss zur finanziellen Absicherung eine Rückdeckungsversicherung ab. Im Jahr 2009 erlitt der Kläger einen Herzinfarkt; seitdem geriet die A-GmbH in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Dies führte ab dem Jahr 2011 zu einer Reduzierung seines Geschäftsführergehalts sowie zu einer Streichung des Urlaubs- und Weihnachtsgelds. Als der A-GmbH im Jahr 2012 die Zahlungsunfähigkeit drohte, beschloss die Gesellschafterversammlung, die Pensionszusage zum 1.12.2012 gegen Zahlung einer Abfindung aufzuheben. Die Rückdeckungsversicherung wurde gekündigt, und es gab weitere Sanierungsmaßnahmen. Das Finanzamt erfasste die Abfindung als verdeckte Gewinnausschüttung beim Kläger.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hiergegen gerichteten Klage statt: Die Zahlung der Abfindung war keine verdeckte Gewinnausschüttung, da sie nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst war. Die Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis ist zu verneinen, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer den Vorteil auch einem Nichtgesellschafter gewährt hätte. Allerdings ist auch der Vertragspartner einzubeziehen, so dass eine Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis vorliegen kann, wenn ein Dritter der für die Kapitalgesellschaft vorteilhaften Vereinbarung nicht zugestimmt hätte. Bei einer Abfindung einer Pensionsanwartschaft kommt es damit zu einem sog. doppelten Fremdvergleich, weil auch die Interessenlage des gedachten und objektiven Vertragspartners zu berücksichtigen ist. Im Streitfall hätte sowohl ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer als auch ein gedachter und objektiver Vertragspartner dem Verzicht und der Abfindung zugestimmt. Die A-GmbH befand sich im Streitjahr in der wirtschaftlichen Krise, und es drohte die Zahlungsunfähigkeit. Die Abfindung samt Verzicht sowie die Auflösung der Rückdeckungsversicherung dienten der Abwendung der Zahlungsunfähigkeit und der Milderung der wirtschaftlichen Krise. Auch wenn die Abfindung niedriger war als der bereits erdiente Anspruch des Klägers aus dem werthaltigen Teil der Anwartschaft, ging es dem Kläger auch um den Erhalt der A-GmbH und damit um die Sicherung seines Arbeitsplatzes bei der A-GmbH. Hinweise: Bei einem beherrschenden Gesellschafter muss eine Vereinbarung zwischen der GmbH und dem Gesellschafter im Vorhinein getroffen werden, zivilrechtlich wirksam sowie klar sein; man nennt dies den formellen Fremdvergleich. Diese Voraussetzung war im Streitfall erfüllt; denn die Abfindungsvereinbarung wurde vor der Zahlung getroffen, und sie war eindeutig, da die Pensionszusage aufgehoben und die Zahlung geregelt wurde.In einer früheren Entscheidung hatte der BFH eine Abfindung, die dem beherrschenden Gesellschafter ohne Abfindungsmöglichkeit in der Pensionszusage gezahlt wurde, als sog. Spontanabfindung bezeichnet und als verdeckte Gewinnausschüttung eingestuft. Dabei handelte es sich jedoch um eine Einzelfallentscheidung, die darauf beruhte, dass die Abfindung durch einen geplanten Anteilsverkauf veranlasst war. Auch wenn die Abfindung nicht als verdeckte Gewinnausschüttung besteuert wird, ist sie doch als Arbeitslohn zu besteuern. Wie groß der steuerliche Unterschied ist, lässt sich dem aktuellen BFH-Beschluss nicht entnehmen, da sämtliche Beträge anonymisiert wurden. Quelle: BFH, Beschluss vom 17.9.2025 – VIII R 17/23; NWB
-
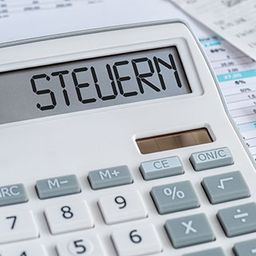
Schuldner der Grunderwerbsteuer
Vereinbaren Käufer und Verkäufer eines Grundstücks, dass sie die Grunderwerbsteuer jeweils zur Hälfte tragen, und nimmt das Finanzamt jedoch ausschließlich den Käufer für die gesamte Grunderwerbsteuer in Anspruch, muss das Finanzamt im Grunderwerbsteuerbescheid begründen, warum es den Verkäufer, der vertraglich die Grunderwerbsteuer zur Hälfte übernehmen sollte, nicht anteilig in Anspruch nimmt. Hintergrund: Nach dem Gesetz sind die Vertragspartner eines Grundstückskaufvertrags Gesamtschuldner der Grunderwerbsteuer. In der Praxis wird im Kaufvertrag meist vereinbart, dass der Käufer die Grunderwerbsteuer trägt. Dementsprechend richtet das Finanzamt den Grunderwerbsteuerbescheid dann auch nur gegen den Käufer. Sachverhalt: Die C-KG erwarb von der X-GmbH Miteigentumsanteile an zwei Grundstücken. Nach dem Kaufvertrag sollten die X-GmbH und die C-KG die Grunderwerbsteuer jeweils hälftig tragen. Das Finanzamt erließ einen Grunderwerbsteuerbescheid nur gegenüber der C-KG und setzte die gesamte Grunderwerbsteuer ihr gegenüber fest, ohne zu begründen, weshalb es nur gegenüber der C-KG einen Grunderwerbsteuerbescheid in voller Höhe erlassen hat. Auch in der Einspruchsentscheidung erfolgte keine Begründung. Die C-KG wehrte sich gegen den Grunderwerbsteuerbescheid. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage statt: Der Grunderwerbsteuerbescheid war formell rechtswidrig, da beide Vertragspartner Gesamtschuldner der Grunderwerbsteuer waren, das Finanzamt aber nur die C-KG in Anspruch genommen hat, ohne dies zu begründen. Die Entscheidung, gegen welchen der Gesamtschuldner die Grunderwerbsteuer festgesetzt wird, ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Grundsätzlich ist es ermessensfehlerfrei, denjenigen Vertragspartner in Anspruch zu nehmen, der im Kaufvertrag die Grunderwerbsteuer übernommen hat. Gegenüber dem anderen Vertragspartner darf ein Grunderwerbsteuerbescheid erst dann ergehen, wenn der zuerst in Anspruch genommene Gesamtschuldner die Grunderwerbsteuer nicht entrichtet hat oder wenn eine Grunderwerbsteuerfestsetzung gegenüber diesem Vertragspartner nicht mehr ergehen kann, z. B. wegen Verjährung. Entspricht der Grunderwerbsteuerbescheid der vertraglichen Vereinbarung, muss das Finanzamt sein Ermessen nicht begründen. Nimmt das Finanzamt aber – wie im Streitfall – einen Vertragspartner in Anspruch, der sich vertraglich nicht zur (vollständigen) Übernahme der Grunderwerbsteuer verpflichtet hat, muss es seine Auswahlentscheidung begründen. Fehlt diese Begründung, ist der Bescheid bereits aus diesem Grund rechtswidrig und aufzuheben. Im Streitfall hat das Finanzamt seine Entscheidung, nur die C-KG für die Grunderwerbsteuer in Anspruch zu nehmen, obwohl nach dem Kaufvertrag die C-KG und die X-GmbH jeweils die Hälfte der Grunderwerbsteuer tragen sollten, nicht begründet. Der Bescheid war daher aufzuheben. Hinweise: Fehlt eine Ermessensausübung oder die Begründung der Ermessensentscheidung, kann das Finanzamt dies noch in der Einspruchsentscheidung nachholen. Aber auch dies ist im Streitfall nicht geschehen. Das Finanzamt hätte spätestens in der Einspruchsentscheidung darlegen müssen, dass es sein Auswahlermessen, wen der beiden Vertragspartner es in welchem Umfang in Anspruch nimmt, tatsächlich ausgeübt hat, und es hätte die Auswahl der Klägerin (C-KG) als Schuldnerin der gesamten Steuer begründen müssen. Im Klageverfahren kann das Finanzamt seine Ermessensentscheidung und die Begründung zur Ermessensausübung nicht mehr nachholen, sondern die Begründung nur noch ergänzen. Quelle: BFH, Urteil vom 2.7.2025 – II R 19/22; NWB
