Aktuelles
-

Unentgeltlicher Erwerb eigener Anteile der GmbH durch Alleingesellschafter
Hält ein GmbH-Gesellschafter 1/3 der GmbH-Anteile, während die verbleibenden 2/3 der Anteile von der GmbH als eigene Anteile selbst gehalten werden, führt der unentgeltliche Erwerb der eigenen Anteile durch den GmbH-Gesellschafter nur dem Grunde nach zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Die verdeckte Gewinnausschüttung beträgt der Höhe nach 0 €, da die erworbenen Anteile für den Alleingesellschafter keinen Wert haben. Hintergrund: Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt bei einer Vermögensminderung oder auch verhinderten Vermögensmehrung einer Kapitalgesellschaft vor, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und nicht zu einer offenen Gewinnausschüttung gehört. Die verdeckte Gewinnausschüttung erhöht das Einkommen der Kapitalgesellschaft und wird beim Gesellschafter als Kapitaleinnahme versteuert. Ein typisches Beispiel für eine verdeckte Gewinnausschüttung ist ein überhöhtes Gehalt für den Gesellschafter-Geschäftsführer oder die Gewährung eines zinslosen Darlehens an den Gesellschafter. Sachverhalt: Die Klägerin war eine GmbH, die 2/3 der Anteile als eigene Anteile hielt. Das verbleibende Drittel der GmbH-Anteile hielt der Gesellschafter C. Nach der Satzung der Klägerin bedurfte die Übertragung von GmbH-Anteilen der Zustimmung der Gesellschafter. Mit notariellem Vertrag vom 20.5.2016 übertrug die Klägerin die von ihr gehaltenen eigenen Anteile unentgeltlich auf C. Das Finanzamt sah hierin eine verdeckte Gewinnausschüttung und setzte gegenüber der Klägerin Kapitalertragsteuer fest. Hiergegen wehrte sich die Klägerin.Entscheidung: Das Finanzgericht Münster (FG) gab der Klage statt: Zwar war dem Grunde nach eine verdeckte Gewinnausschüttung zugunsten des C zu bejahen, die bei der Klägerin an sich der Kapitalertragsteuer unterliegt. Die unentgeltliche Übertragung der eigenen Anteile auf den C war durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, weil die Klägerin einem Nicht-Gesellschafter die eigenen Anteile nicht unentgeltlich übertragen hätte. Bei C kam es dem Grunde nach zu einer Ausschüttung, weil die eigenen Anteile für ihn Wirtschaftsgüter darstellten, die er z.B. veräußern konnte. Der Wert der unentgeltlich überlassenen Anteile betrug jedoch Null, da C bereits vor der Übertragung Alleingesellschafter war. C hielt nämlich 1/3 der GmbH-Anteile, während die verbleibenden 2/3 der Anteile von der GmbH selbst gehalten wurden. Damit gab es nur den C als Gesellschafter. Sämtliche Gewinnbezugs- und Stimmrechte standen somit schon vor der Übertragung dem C zu; eigene Anteile, die eine GmbH selbst hält, sind nämlich nicht mit Stimm- und Gewinnbezugsrechten ausgestattet, so dass nur C stimm- und gewinnbezugsberechtigt war. Die Übertragung der eigenen Anteile durch die Klägerin auf C trug auch nicht dazu bei, dass die Alleingesellschafterstellung des C gesichert wird. Denn C musste nicht befürchten, dass die Klägerin ihre eigenen Anteile an einen Dritten veräußert. Die Klägerin konnte ihre eigenen Anteile nämlich nicht ohne Zustimmung des C, der die alleinigen Stimmrechte hielt, übertragen. Aufgrund der Satzung bedurfte die Übertragung von GmbH-Anteilen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Hinweise: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat vor kurzem einen ähnlichen Fall entschieden, dort eine verdeckte Gewinnausschüttung dem Grunde nach bejaht, aber die Höhe der verdeckten Gewinnausschüttung offengelassen, und den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Der BFH hatte angedeutet, dass die verdeckte Gewinnausschüttung nur einen geringen Wert, ggf. sogar nur 0 €, haben könnte. Das FG hat im aktuellen Fall, der mit dem vom BFH entschiedenen Sachverhalt nicht identisch ist, den Wert der verdeckten Gewinnausschüttung nun mit 0 € angesetzt. Zwar konnte C die Anteile, die er von der Klägerin unentgeltlich erhalten hat, veräußern; zugleich sank aber der Wert seiner bisherigen Beteiligung. Der Erwerb eigener Anteile durch eine GmbH stellt wirtschaftlich betrachtet eine Auskehrung frei verfügbarer Rücklagen an die Gesellschafter dar und ähnelt daher einer Kapitalherabsetzung. Überträgt die GmbH die eigenen Anteile später an einen Gesellschafter, ist dies mit einer Kapitalerhöhung vergleichbar. Ein eigener Anteil hat für die GmbH keinen Wert. Quelle: FG Münster, Urteil vom 29.10.2025 – 9 K 1180/22 Kap; NWB
-

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Januar 2026
Das Bundesfinanzministerium hat die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2026 bekannt gegeben. Die monatlich fortgeschriebene Übersicht 2026 können Sie auf der Homepage des BMF abrufen.Quelle: BMF, Schreiben v. 2.2.2026 – III C 3 – S 7329/00014/008/002; NWB
-
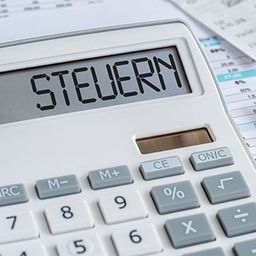
Verjährung bei der Schenkungsteuer bei Anzeige der Schenkung
Zeigt ein Steuerpflichtiger eine Schenkung beim Finanzamt an und fordert ihn das Finanzamt anschließend zur Abgabe einer Schenkungsteuererklärung auf, beginnt die vierjährige Verjährungsfrist erst mit Ablauf des Jahres, in dem die Steuererklärung beim Finanzamt abgegeben wird, spätestens mit Ablauf des dritten Jahres nach dem Jahr, in dem die Schenkung erfolgt ist. Die Verjährung beginnt indes nicht schon mit Ablauf des Jahres, in dem die Anzeige erstattet worden ist. Hintergrund: Grundsätzlich beträgt die Festsetzungsverjährung vier Jahre und beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Steuer entstanden ist, bei einer Schenkung also mit Ablauf des Jahres, in dem die Schenkung ausgeführt worden ist. Der Gesetzgeber hat aber eine sog. Anlaufhemmung geregelt, bei der die Verjährungsfrist erst später beginnt: Ist eine Steuererklärung einzureichen oder eine Anzeige (über einen bestimmten Vorgang) zu erstatten, beginnt die Verjährungsfrist erst mit Ablauf des Jahres, in dem die Erklärung eingereicht oder die Anzeige erstattet wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Jahr der Entstehung der Steuer folgt. Sachverhalt: Der Kläger war Alleingesellschafter der A-GmbH. Am 31.7.2014 verpflichtete sich seine Mutter privatschriftlich, also nicht notariell, ihm 4 Mio. € zu schenken. Allerdings erfolgte die Schenkung unter der Auflage, dass der Kläger den Geldbetrag nach Abzug der hierfür entstehenden Schenkungsteuer in die A-GmbH einlegen musste, damit diese ein bestimmtes Grundstück erwerben kann. Die A-GmbH erwarb mit Vertrag vom 20.8.2014 das genannte Grundstück zum Preis von 3,25 Mio. €; den Kaufpreis musste die A-GmbH aber erst zum 31.12.2014 entrichten. Der Notar sollte erst nach der Bezahlung des Kaufpreises die Eigentumsumschreibung beim Grundbuchamt beantragen. Am 22.9.2014 zahlte die Mutter auf das Konto des Klägers 4 Mio. € ein. Der Kläger überwies hiervon 3,7 Mio. € auf das Konto der A-GmbH, die am 30.12.2014 den Kaufpreis an den Verkäufer überwies. Der Kläger behielt die Differenz von 300.000 € für die Bezahlung der Schenkungsteuer ein. Bereits am 17.12.2014 hatte der Kläger die Schenkung beim Finanzamt angezeigt. Das Finanzamt forderte vom Kläger eine Schenkungsteuererklärung an, die der Kläger am 26.2.2015 einreichte. Das Finanzamt erließ noch im Jahr 2015 einen Schenkungsteuerbescheid. Im Jahr 2019 gab der Kläger eine weitere Schenkungsteuererklärung ab und erklärte Vorschenkungen seiner Mutter in Höhe von insgesamt 700.000 €, in denen auch der für die Bezahlung der Schenkungsteuer vorgesehene Betrag von 300.000 € enthalten war. Das Finanzamt erhöhte daraufhin im November 2019 die Schenkungsteuerfestsetzung durch einen Bescheid. Hiergegen legte der Kläger fristgerecht Einspruch ein. Im Januar 2020 erhöhte das Finanzamt erneut die Schenkungsteuer, nachdem das für die Bewertung des Grundstücks zuständige Finanzamt den steuerlichen Wert des Grundstücks durch Feststellungsbescheid erhöht hatte. Der Kläger machte geltend, dass bei Erlass der Schenkungsteuerbescheide im November 2019 und Januar 2020 bereits Verjährung eingetreten sei. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte einen Verjährungseintritt und wies die Klage ab: Die Zahlung der Mutter unter der Auflage, das Geld nach Abzug der voraussichtlich entstehenden Schenkungsteuer in die A-GmbH einzuzahlen, damit die A-GmbH ein bestimmtes Grundstück erwirbt, stellte eine Schenkung der Mutter an den Kläger dar. Denn die Einzahlung in die A-GmbH führte beim Kläger zu einer Werterhöhung seiner Beteiligung. Unbeachtlich war, dass die Mutter an der A-GmbH nicht selbst beteiligt war. Die Werterhöhung setzte sich aus der Zahlung in Höhe von 3,7 Mio. € und dem Grundstück mit einem steuerlichen Wert von 2.100.574 € abzüglich des Grundstückskaufpreises und Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 3.505.192 € zusammen, so dass sich eine steuerpflichtige Werterhöhung der GmbH-Beteiligung des Klägers in Höhe von 2.295.382 € ergab. Außerdem waren bei der Höhe der Schenkung auch die Vorschenkungen in Höhe von 700.000 € zu berücksichtigen. Eine Verjährung war nicht eingetreten. Muss der Steuerpflichtige eine Anzeige erstatten und wird er anschließend zur Abgabe der Steuererklärung aufgefordert, wird die Anlaufhemmung erst mit der Abgabe der Steuererklärung beendet. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen Zwecksetzungen der Anzeige und der Steuererklärung. Die Anzeige soll dem Finanzamt die Prüfung erleichtern, ob und wen es zur Abgabe einer Steuererklärung auffordert. Erst die Steuererklärung ermöglicht die Festsetzung der Schenkungsteuer, so dass für die Beendigung der Anlaufhemmung auf die Abgabe der Erklärung abzustellen ist. Da die Schenkungsteuererklärung im Jahr 2015 abgegeben worden war, begann die vierjährige Festsetzungsfrist mit Ablauf des 31.12.2015 und endete am 31.12.2019. Daher war der Schenkungsteuerbescheid aus dem November 2019 nicht verjährt. Auch der Bescheid aus dem Jahr 2020 war nicht verjährt; denn der Kläger hatte noch im November 2019 Einspruch gegen den geänderten Schenkungsteuerbescheid eingelegt, so dass der Einspruch eine Ablaufhemmung auslöste, die Verjährung also bis zu einer Entscheidung über den Einspruch nicht eintreten konnte. Hinweise: Zu Recht hat das Finanzamt als Bewertungsstichtag für das Grundstück den 31.12.2014 zugrunde gelegt. Denn am 31.12.2014 ist das wirtschaftliche Eigentum an dem Grundstück auf die A-GmbH übergegangen. Erst mit der Bezahlung des Kaufpreises, die am 30.12.2014 erfolgt ist, durfte der Notar den Antrag auf Eigentumseintragung beim Grundbuchamt stellen; es ist daher nicht zu beanstanden, dass der Folgetag (31.12.2014) als Tag des wirtschaftlichen Übergangs angesetzt wurde. Quelle: BFH, Urteil vom 27.8.2025 – II R 1/23; NWB
