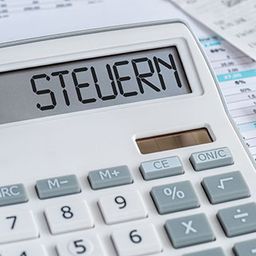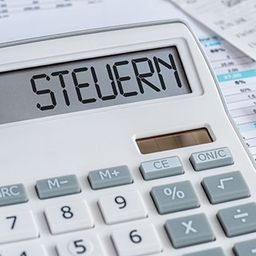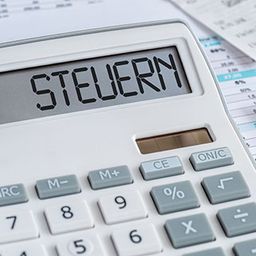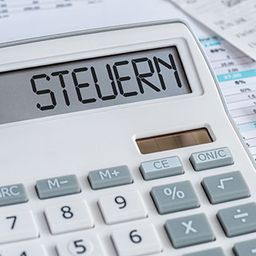Steuerfreier Sanierungsgewinn bei Schuldenerlass zugunsten eines Mitunternehmers
Werden dem Gesellschafter einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft die Schulden erlassen, kann dies zu einem steuerfreien Sanierungsgewinn führen, wenn die gesetzlichen Sanierungsvoraussetzungen bei der Personengesellschaft erfüllt sind. Es genügt nicht, dass bei dem Gesellschafter die gesetzlichen Sanierungsvoraussetzungen vorliegen. Hintergrund: Der Gesetzgeber stellt Sanierungsgewinne steuerfrei, wenn das Unternehmen sanierungsbedürftig und sanierungsfähig ist, wenn eine Sanierungsabsicht der Gläubiger besteht und wenn die Maßnahme, die zum Sanierungsgewinn geführt hat, für die Sanierung geeignet ist. Allerdings gehen im Umfang der Steuerfreiheit die Verlustvorträge unter. Sachverhalt: An einer GmbH & Co. KG waren B zu 5 % und A zu 95 % sowie die Komplementär-GmbH zu 0 % beteiligt. Die GmbH & Co. KG unterhielt einen Pensionsbetrieb, den sie von B gepachtet hatte. B hatte neben dem Pensionsbetrieb auch das dazugehörige Betriebsgrundstück an die GmbH & Co. KG verpachtet, so dass der verpachtete Pensionsbetrieb einschließlich Grundstück zu seinem Sonderbetriebsvermögen gehörte. Zu seinem Sonderbetriebsvermögen gehörten auch Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse; die Sparkasse hatte ihre Forderungen gegen B mit Grundschulden auf dem Betriebsgrundstück gesichert. Da sich der Pensionsbetrieb in finanziellen Schwierigkeiten befand, verhandelte B mit der Sparkasse über einen Schuldenerlass. Die Sparkasse erklärte sich bereit, auf die Hälfte ihrer Forderungen gegen B zu verzichten, falls B eine Einmalzahlung in Höhe von 350.000 € leisten würde. B zahlte im Streitjahr 2013 an die Sparkasse 350.000 €; diesen Betrag finanzierte er mit zwei Darlehen der Volksbank. Aufgrund der Einmalzahlung des B verzichtete die Sparkasse im Jahr 2013 auf ca. 350.000 €, so dass B im Jahr 2013 einen Ertrag von ca. 350.000 € erzielte, den er als steuerfreien Sanierungsgewinn behandelte. Dem folgte das Finanzamt nicht. Entscheidung: Der BFH konnte nicht abschließend entscheiden, ob die Voraussetzungen eines steuerfreien Sanierungsgewinns erfüllt waren, und verwies die Sache an das Finanzgericht (FG) zur weiteren Aufklärung zurück: Bei einem Schuldenerlass gegenüber dem Gesellschafter einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) kommt es bezüglich der Steuerfreiheit eines Sanierungsgewinns darauf an, ob die gesetzlichen Sanierungsvoraussetzungen bei der Mitunternehmerschaft (GmbH & Co. KG) erfüllt sind. Es müssen die Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens der Mitunternehmerschaft, die Sanierungsabsicht der Gläubiger sowie die Sanierungseignung der Maßnahme, die zum Sanierungsgewinn geführt hat, für das Unternehmen der Mitunternehmerschaft bejaht werden. Es genügt hingegen nicht, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns nur in der Person des Mitunternehmers, d.h. in der Person des B, vorliegen. Im Streitfall waren die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens der GmbH & Co. KG sowie die Sanierungsabsicht der Sparkasse zu bejahen. Die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens der GmbH & Co. KG war zu bejahen, weil das Sonderbetriebsvermögen des B überschuldet war und weil die GmbH & Co. KG ohne den Schuldenerlass in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten wäre. Denn das von B verpachtete Betriebsgrundstück war durch Grundschulden zugunsten der Sparkasse gesichert, so dass die GmbH & Co. KG bei einer Vollstreckung der Sparkasse gegen B möglicherweise ihre Betriebsgrundlage verloren hätte. Auch die Sanierungsabsicht der Sparkasse war zu bejahen, weil für die Sparkasse die Sanierungsabsicht für den Schuldenerlass mitentscheidend gewesen ist. Dies ergab sich aus dem vorgelegten Schriftverkehr sowie aus einer Zeugenaussage eines Mitarbeiters der Sparkasse. Allerdings ließen sich die Sanierungsfähigkeit sowie die Sanierungseignung nicht feststellen. Dies muss nun das FG ermitteln. Hinweise: Für die Sanierungsfähigkeit und Sanierungseignung müsste feststehen, dass aufgrund des Schuldenerlasses der Sparkasse die Ertragsfähigkeit der GmbH & Co. KG hergestellt werden konnte. Dies war nach den bisherigen Sachverhaltsfeststellungen zweifelhaft; denn das Betriebsgrundstück mit der Pension bedurfte einer umfangreichen Sanierung. Es waren also wohl weitere finanzielle Mittel erforderlich, um das Pensionsgebäude zu sanieren. Hinzu kam, dass auf dem Nachbargrundstück der GmbH & Co. KG ein Konkurrent ebenfalls einen Übernachtungsbetrieb eröffnet hatte. Dies erschwerte die Ertragsfähigkeit der GmbH & Co. KG.Auch wenn es sich bei der Sanierungsfähigkeit und der Sanierungseignung formal gesehen um zwei unterschiedliche Sanierungsvoraussetzungen zu handeln scheint, werden beide Voraussetzungen faktisch zusammengeprüft. Dem BFH zufolge kann die Sanierungsfähigkeit daher bejaht werden, wenn der Schuldenerlass für die Sanierung geeignet ist. Quelle: BFH, Urteil vom 21.8.2025 – IV R 23/23; NWB