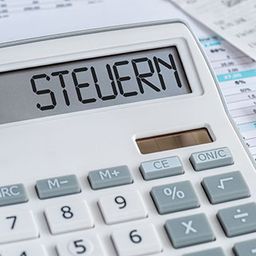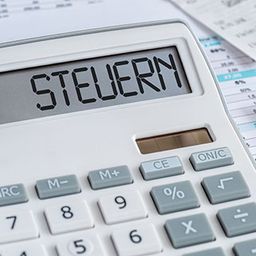Abfindung für Verzicht auf Nießbrauch an einem vermieteten Grundstück
Eine Abfindung für den Verzicht auf einen Nießbrauch an einem vermieteten Grundstück ist steuerbar, da sie eine steuerbare Entschädigung für entgehende Einnahmen darstellt; denn ohne den Verzicht würde der Nießbraucher auch weiterhin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Für die Steuerbarkeit kommt es nicht darauf an, ob der Nießbraucher bei der Verzichts- und Abfindungsvereinbarung unter rechtlichem, wirtschaftlichem oder tatsächlichem Druck stand. Hintergrund: Zu den steuerbaren Einkünften gehören auch Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt worden sind. Sachverhalt: Die Klägerin hatte ein lebenslanges Nießbrauchsrecht an einem Grundstück. Eigentümerin des Grundstücks war eine Erbengemeinschaft, an der die Kinder der Klägerin beteiligt waren. Die Klägerin vermietete das Grundstück und erzielte hieraus Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die Erbengemeinschaft veräußerte im Jahr 2011 das Grundstück. Anschließend verzichtete die Klägerin auf ihr Nießbrauchsrecht und erhielt hierfür noch im Jahr 2011 eine Abfindung von einer Gesellschaft, an die sie das Grundstück zuletzt vermietet hatte und an der die Kinder der Klägerin beteiligt waren. Das Finanzamt erfasste die Abfindung als steuerpflichtigen Spekulationsgewinn im Jahr 2011. Hiergegen klagte die Klägerin. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die Abfindung für steuerbar, ordnete sie aber den Entschädigungen im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu und verwies die Sache zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zurück: Die Abfindung stellte eine Entschädigung dar, die als Ersatz für entgehende Vermietungseinnahmen gewährt wurde. Sie war damit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzuordnen. Eine Entschädigung ist steuerbar, wenn sie für den Wegfall einer steuerbaren Einnahme gezahlt wird. Hingegen ist eine Entschädigung nicht steuerbar, wenn sie für den Verlust eines Wirtschaftsguts gezahlt wird. Ein Nießbrauchsrecht ist zwar ein Wirtschaftsgut; gleichwohl ist die Abfindung, die für den Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht gezahlt wird, bei wirtschaftlicher Betrachtung jedenfalls dann eine steuerbare Entschädigung für entgehende Einnahmen, wenn der Nießbraucher das Grundstück im Zeitpunkt des Verzichts auf den Nießbrauch tatsächlich vermietet und hieraus Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt hat. Der wirtschaftliche Kerngehalt des aufgegebenen Rechts ist die tatsächliche Einkünfteerzielung, so dass die Entschädigung an die Stelle der Mieteinnahmen tritt. Für die Frage der Steuerbarkeit ist es unbeachtlich, ob die Klägerin freiwillig auf ihr Nießbrauchsrecht verzichtet hat. Denn das Gesetz stellt in seinem Wortlaut nicht auf eine Freiwilligkeit oder Druck- bzw. Zwangssituation ab. Eine Druck- oder Zwangssituation kann allerdings dazu führen, dass eine Abfindung tarifbegünstigt ist, wenn es aufgrund der Druck- oder Zwangssituation zu einer sog. Zusammenballung von Einkünften gekommen ist. Hinweise: Die Abfindung führte damit nicht zu einem Spekulationsgewinn, sondern zu einer steuerbaren Entschädigung im Rahmen der Vermietungseinkünfte; diese hat gegenüber einer Erfassung als Spekulationsgewinn nach dem Gesetz Vorrang. Das FG muss nun aufklären, ob die Klägerin noch Werbungskosten geltend machen kann, die die Einkünfte mindern würden. Sollte sich die Klägerin in einer Druck- oder Zwangssituation bei Abschluss der Verzichtsvereinbarung befunden haben und sollte es im Streitjahr 2011 zu einem zusammengeballten Zufluss von Einnahmen gekommen sein, muss das FG zudem prüfen, ob der Klägerin eine Tarifbegünstigung zusteht. Mit seinem aktuellen Urteil widerspricht der BFH einer Entscheidung des BFH aus dem Jahr 1992, in der die Steuerbarkeit verneint worden war, sowie der Auffassung des Bundesfinanzministeriums, das die Ablösung eines Vorbehalts- oder Vermächtnisnießbrauchs als nicht steuerbare Vermögensumschichtung ansieht. Quelle: BFH, Urteil vom 10.10.2025 – IX R 4/24; NWB