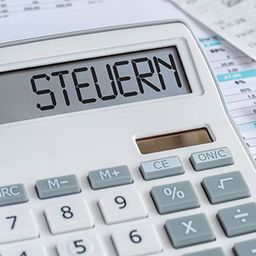Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Vermietung einer Lagerhalle mit Paletten-Förderanlage
Einer Vermietungsgesellschaft, die eine zweigeschossige Lagerhalle vermietet, ist die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer nicht zu gewähren, wenn sich in der Lagehalle neben einem Lastenaufzug auch noch eine Paletten-Förderanlage befindet, die den Transport der per Lkw angelieferten Paletten in das obere Geschoss mit einer größeren Kapazität als der Lastenaufzug ermöglicht. Die Paletten-Förderanlage stellt nämlich eine Betriebsvorrichtung dar und gehört damit nicht mehr zur Verwaltung von Grundbesitz. Hintergrund: Unternehmen, die nur aufgrund ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft oder aufgrund ihrer gewerblichen Prägung als GmbH & Co. KG gewerbesteuerpflichtig sind, tatsächlich aber ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, können eine sog. erweiterte Gewerbesteuerkürzung beantragen. Der Ertrag aus der Grundstücksverwaltung und -nutzung unterliegt dann nicht der Gewerbesteuer. Die Mitvermietung beweglicher Sachen wie z. B. Betriebsvorrichtungen ist aber jedenfalls bis einschließlich 2020 grundsätzlich schädlich, weil sie nicht als Verwaltung eigenen Grundbesitzes angesehen wird. Betriebsvorrichtungen sind Wirtschaftsgüter, die zwar im Gebäude eingebaut sind, aber eine ausschließlich betriebliche Funktion erfüllen, z.B. ein Lastenfahrstuhl oder eine Kühlanlage.Sachverhalt: Die Klägerin war aufgrund ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig. Sie vermietete eine Gewerbeimmobilie in Hamburg, zu der mehrere Lagerhallen gehörten. Zwei Lagerhallen waren zweigeschossig und verfügten jeweils über einen Lastenaufzug sowie über eine Paletten-Förderanlage, mit der die von den Lkw angelieferten Paletten in das Obergeschoss transportiert werden konnten; die Kapazität der Förderanlage war größer als die des Lastenaufzugs. Das Finanzamt versagte für die Streitjahre 2016 bis 2018 die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, weil es in der Paletten-Förderanlage eine Betriebsvorrichtung sah. Entscheidung: Das Finanzgericht Hamburg (FG) wies die Klage ab: Die Paletten-Förderanlage war eine Betriebsvorrichtung; denn sie stand nicht in einem einheitlichen Nutzen- und Funktionszusammenhang zum Gebäude, sondern in einem unmittelbaren und besonderen Verhältnis zu dem Gewerbebetrieb der Mieterin, der in der Lagerhalle betrieben worden ist. Eine Betriebsvorrichtung gehört steuerlich nicht zum Grundbesitz, sondern wird als bewegliches Vermögen angesehen, so dass die Klägerin nicht nur eigenen Grundbesitz verwaltete, sondern auch bewegliche Wirtschaftsgüter, nämlich die Betriebsvorrichtung, mitvermietete. Damit war die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer abzulehnen. Zwar ist die Mitvermietung einer Betriebsvorrichtung gewerbesteuerlich dann unschädlich, wenn es sich dabei um ein unschädliches Nebengeschäft handelt. Dies setzt aber voraus, dass die Mitvermietung der Betriebsvorrichtung ein zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung gewesen ist. Allerdings wäre die Nutzung der Lagerhalle auch ohne Paletten-Förderanlage wirtschaftlich sinnvoll möglich gewesen. Das Finanzgericht hat hierzu ein Gutachten eingeholt; danach gibt es in Hamburg vergleichbare zwei- oder mehrgeschossige Lagerimmobilien, die lediglich über Personen- und Lastenaufzüge verfügen. Allein der Umstand, dass die Klägerin ohne Paletten-Förderanlage eine um 15 % geringere Miete erhalten hätte, zeigt, dass die Paletten-Förderanlage wie ein „Extraeinbau“ zu behandeln ist, der aufgrund des schnelleren Palettenumschlags den Mietwert lediglich erhöhte. Hinweise: Seit dem Erhebungszeitraum 2021 steht die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen der erweiterten Gewerbesteuerkürzung nicht entgegen, wenn die Einnahmen hieraus 5 % der Mieteinnahmen nicht überschreiten. Die Frage, wann Einbauten als Betriebsvorrichtungen eingestuft werden und wann die Mitvermietung ein unschädliches Nebengeschäft ist, wird von den Finanzgerichten nicht einheitlich beurteilt. Teilweise wird z. B. die Mitvermietung von Laderampen und Lastenaufzügen bzw. Lastenfahrstühlen als gewerbesteuerlich unschädlich angesehen. FG Hamburg, Urteil vom 15.5.2024 – 2 K 76/22