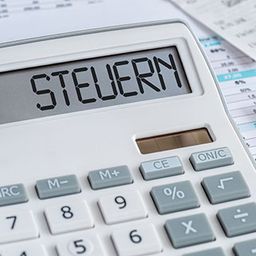Keine Tarifermäßigung für Corona-Hilfen im Jahr des Einnahmeausfalls
Ein Unternehmer, der im Jahr 2020 Corona-Hilfen für Einnahmeausfälle des Jahres 2020 gewinnerhöhend erfasst hat, erhält keine Tarifermäßigung für die Corona-Hilfen. Für eine Tarifermäßigung fehlt es an der erforderlichen Zusammenballung von Einkünften im Jahr 2020.Hintergrund: Für außerordentliche Einkünfte gewährt der Gesetzgeber eine sog. Tarifermäßigung, durch die der Steuersatz gemindert wird. Zu den außerordentlichen Einkünften gehören u.a. Entschädigungen für entgangene oder entgehende Einnahmen und Entschädigungen für die Nichtausübung einer Tätigkeit. Die Tarifermäßigung setzt voraus, dass es aufgrund der außerordentlichen Einkünfte zu einer sog. Zusammenballung von Einkünften und damit zunächst zu einer Erhöhung des Steuersatzes gekommen ist.Sachverhalt: Der Kläger war Schausteller und ermittelte seinen Gewinn durch Bilanzierung. Aufgrund der Corona-Krise sanken seine Betriebseinnahmen im Jahr 2020 von ca. 480.000 € in den Vorjahren auf 130.000 €. Dem Kläger wurden im Jahr 2020 Corona-Hilfen in Höhe von ca. 150.000 € gewährt, die er gewinnerhöhend erfasste. Seine Betriebsausgaben betrugen im Jahr 2020 ca. 170.000 €, so dass sich sein Gewinn für 2020 auf ca. 110.000 € belief. In den Vorjahren hatte der Kläger Betriebsausgaben in Höhe von etwa 400.000 € jährlich getätigt. Der Kläger beantragte für 2020 die Tarifermäßigung für die Corona-Hilfen. Das Finanzgericht wies die Klage ab, und der Kläger legte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein.Entscheidung: Der BFH wies die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision als unbegründet zurück: Zwar hat der Kläger im Streitjahr 2020 außerordentliche Einkünfte erzielt. Die Corona-Hilfen stellten nämlich Entschädigungen für entgangene Einnahmen bzw. für die Nichtausübung einer Tätigkeit dar. Es fehlte jedoch an einer Zusammenballung von Einkünften. Denn die Betriebseinnahmen des Jahres 2020 betrugen lediglich rund 280.000 € (Einnahmen aus dem Schaustellergeschäft zuzüglich Corona-Hilfen) und waren damit niedriger als in den Vorjahren, in denen er jeweils ca. 480.000 € erzielt hatte. Zwar betrug der Gewinn im Jahr 2020 ca. 110.000 € und war damit höher als in den Vorjahren, als er sich durchschnittlich nur auf etwa 80.000 € belief. Der höhere Gewinn im Jahr 2020 beruhte jedoch nicht auf einer Zusammenballung von Einkünften bzw. Einnahmen, sondern auf einer Minderung der Betriebsausgaben. Zu einer Zusammenballung wäre es nur dann gekommen, wenn der Kläger im Streitjahr 2020 noch Einnahmen erzielt hätte, die normalerweise in anderen Jahren angefallen wären. Die im Jahr 2020 gewährten Corona-Hilfen betrafen aber das Jahr 2020. Hinweise: Eine Entschädigung für entgangene Einnahmen führt dann zu einer Zusammenballung von Einkünften und damit zu einem höheren Steuersatz, wenn die Entschädigung nicht in dem Jahr gezahlt wird, in dem die entgangenen Einnahmen an sich erzielt worden wären, sondern in einem vorherigen Jahr, in dem die Einnahmen noch fließen. Beispiel: A erzielt jährlich 50.000 € aus der Vermietung eines Gebäudes an einen Unternehmer; der Mietvertrag endet am 31.12.2030. Im Jahr 2025 vereinbart A mit dem Unternehmer, dass dieser den Mietvertrag zum 31.12.2025 beenden kann. Hierfür zahlt der Unternehmer dem A im Jahr 2025 eine Entschädigung von 200.000 €. Bei A kommt es nun im Jahr 2025 zu einer Zusammenballung von Einkünften, weil er neben der regulären Miete in Höhe von 50.000 € zusätzlich noch eine Entschädigung von 200.000 € im Jahr 2025 versteuern muss und damit einem höheren Steuersatz unterliegt. Im Streitfall führte die Gewährung von Corona-Hilfen sowie die Minderung der Betriebsausgaben nur zu einer Schwankung der Gewinnhöhe. Der Fall war also nicht anders zu beurteilen, als wenn der Kläger aus der normalen betrieblichen Tätigkeit als Schausteller einen ungewöhnlich hohen Gewinn im Jahr 2020 erzielt hätte. Eine solche Schwankung ist bei gewerblichen Einkünften aber nicht „außergewöhnlich“ und rechtfertigt daher keine Tarifermäßigung.Quelle: BFH, Beschluss vom 28.11.2025 – X B 27/25; NWB