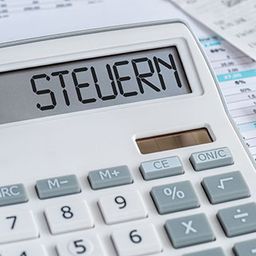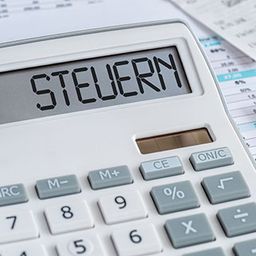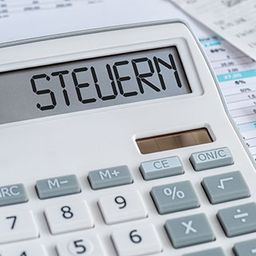Vom Arbeitnehmer für Dienstwagen übernommene Stellplatzmiete
Zahlt ein Arbeitnehmer die Stellplatzmiete für einen Dienstwagen, den er auch privat nutzen darf, mindert die Stellplatzmiete nicht seinen geldwerten Vorteil, der sich aus der privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens ergibt. Hintergrund: Kann der Arbeitnehmer einen Dienstwagen für Privatfahrten nutzen, muss er den sich hieraus ergebenden geldwerten Vorteil nach der sog. 1 %-Methode versteuern, d.h. mit monatlich 1 % des Bruttolistenpreises (zuzüglich der Kosten für die Sonderausstattung und einschließlich Umsatzsteuer). Sofern der Arbeitnehmer ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führt, kann er den geldwerten Vorteil auch anhand der auf die Privatfahrten tatsächlich entfallenden Aufwendungen ermitteln.Sachverhalt: Die Klägerin war Arbeitgeberin und beschäftigte den A. Sie überließ A einen Dienstwagen, den dieser auch privat nutzen durfte. A mietete einen Stellplatz in der Nähe des Betriebs für 30 €/Monat an. Die Klägerin zog die von A getragenen 30 € vom dem nach der 1 %- Methode errechneten geldwerten Vorteil ab. Das Finanzamt erkannte die Minderung nicht an, sondern erließ gegenüber der Klägerin einen Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage ab: Aufgrund der privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens erlangte A einen geldwerten Vorteil, für den die Klägerin Lohnsteuer einbehalten und abführen musste. Der geldwerte Vorteil war – mangels Führung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs – nach der sog. 1 %-Methode zu ermitteln, also in Höhe von 1 % des Bruttolistenpreises (zuzüglich der Kosten für die Sonderausstattung und einschließlich Umsatzsteuer) monatlich. Der sich danach ergebende Wert war nicht um die Stellplatzmiete in Höhe von 30 € monatlich zu mindern. Eine Minderung des geldwerten Vorteils ist nur dann möglich, wenn die vom Arbeitnehmer getragenen Kosten in dem gedachten Fall, dass sie vom Arbeitgeber getragen würden, von der Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung erfasst worden wären, also nicht gesondert versteuert werden müssten. Hätte die Klägerin die Stellplatzmiete übernommen, wäre dieser Vorteil nicht von der 1 %-Regelung erfasst worden, sondern hätte zusätzlich von A versteuert werden müssen.Hinweis: Mit dem Urteil setzt der BFH seine aktuelle Rechtsprechung fort, nach der Kosten, die der Arbeitnehmer selbst trägt, den geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens nicht mindern, soweit diese Kosten nicht von der Abgeltungswirkung der 1 %-Methode erfasst werden, falls sie vom Arbeitgeber getragen würden. So hat der BFH etwa auch Fährkosten, die der Arbeitnehmer auf einer privaten Urlaubsreise übernommen hat, nicht vom geldwerten Vorteil abgezogen. Denn hätte der Arbeitgeber die Fährkosten übernommen, hätten sie zusätzlich versteuert werden müssen. Zu einer Minderung des geldwerten Vorteils in Höhe der Stellplatzmiete wäre es im Streitfall nur dann gekommen, wenn die Nutzung des Stellplatzes im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin als Arbeitgeberin erfolgt wäre. Dies kann dann der Fall sein, wenn im Fahrzeug wertvolle Werkzeuge aufbewahrt werden, so dass der Dienstwagen in einer Garage abzustellen ist.Zu einer Minderung des geldwerten Vorteils, der sich aus der privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens ergibt, kommt es im Übrigen dann, wenn der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt an den Arbeitgeber für die private Nutzung des Dienstwagens entrichtet oder wenn er zeitraumbezogene Einmalzahlungen für die private Nutzung leistet oder wenn er einen Teil der Anschaffungskosten für den Dienstwagen übernimmt.Quelle: BFH, Urteil vom 9.9.2025 – VI R 7/23; NWB