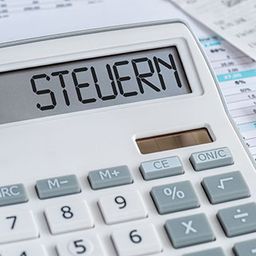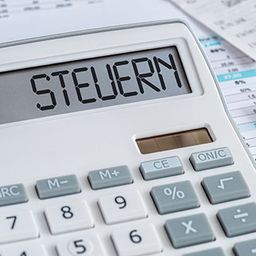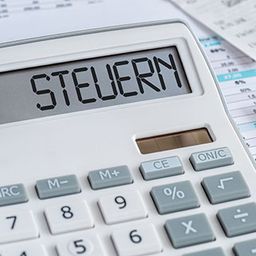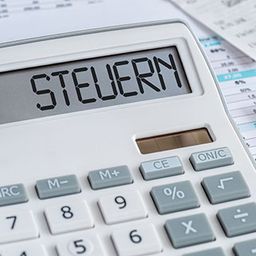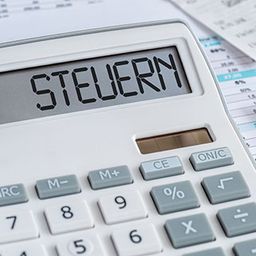Geplante Gesetzesänderung zur Übertragung stiller Reserven bei Anteilsübertragungen
Der Gesetzgeber will die Übertragung stiller Reserven, die bei einer Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften realisiert werden, erleichtern. Der bisherige Höchstbetrag von 500.000 € soll auf 2 Mio. € angehoben werden. Hintergrund: Natürliche Personen oder Personengesellschaften, soweit an ihnen natürliche Personen beteiligt sind, können einen Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften auf bestimmte andere Wirtschaftsgüter übertragen: auf Anteile an Kapitalgesellschaften, auf abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter oder auf Gebäude. Der Gewinn muss dann nicht versteuert werden, sondern mindert die Anschaffungskosten der Anteile, Wirtschaftsgüter oder Gebäude und damit auch die Abschreibungen, soweit es sich um abnutzbare Wirtschaftsgüter handelt (bewegliche Wirtschaftsgüter und Gebäude). Der bisherige Höchstbetrag beläuft sich auf 500.000 €.Inhalt der geplanten Neuregelung: Der Höchstbetrag von bislang 500.000 € soll auf 2 Mio. € angehoben werden. Der neue Höchstbetrag soll für Veräußerungsgewinne gelten, die in einem Wirtschaftsjahr entstehen, das nach der Verkündung des Gesetzes beginnt. Sollte das Gesetz also noch in diesem Jahr (2025) verabschiedet werden, würde die Neuregelung für Veräußerungsgewinne gelten, die im Wirtschaftsjahr 2026 entstehen. Hinweis: Die Reinvestition in Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder in abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter kann der Steuerpflichtige im Jahr des Veräußerungsgewinns oder in den beiden folgenden Wirtschaftsjahren vornehmen. Will er die Reinvestition in ein Gebäude vornehmen, das er anschafft oder herstellt, muss er diese im Jahr des Veräußerungsgewinns oder in den folgenden vier Wirtschaftsjahren vornehmen. Für Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, soweit an ihnen Kapitalgesellschaften beteiligt sind, gilt die Übertragungsmöglichkeit nicht; denn Kapitalgesellschaften können Anteile an anderen Kapitalgesellschaften steuerfrei verkaufen; vom steuerfreien Gewinn werden aber 5 % als nicht abziehbare Betriebsausgaben angesetzt, so dass im Ergebnis 95 % des Gewinns nicht versteuert werden müssen. Quelle: Entwurf eines Standortfördergesetzes (StoFöG), Stand des Referentenentwurfs vom 22.8.2025; NWB