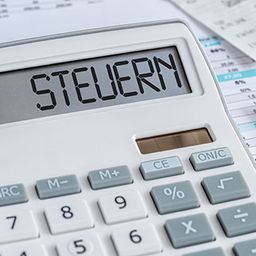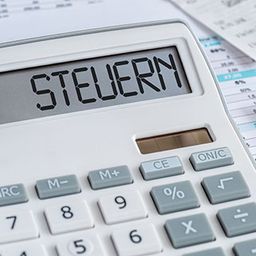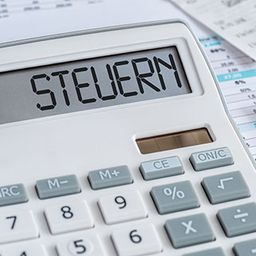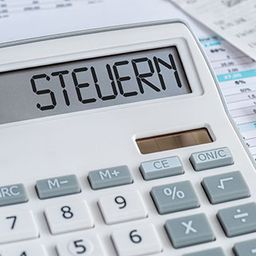Umsatzsteuer eines Fitnessstudios im Corona-Lockdown
Der Betreiber eines Fitnessstudios, der sein Studio im Jahr 2020 wegen der Corona-Maßnahmen schließen musste, aber weiterhin Mitgliedsbeiträge erhielt, schuldet die Umsatzsteuer auf die erhaltenen Mitgliedsbeiträge. Eine Berichtigung dieser Umsatzsteuer zu seinen Gunsten ist erst dann möglich, wenn er die Beiträge zurückzahlt.Hintergrund: Umsatzsteuer entsteht, wenn ein Unternehmer eine Leistung gegen Entgelt erbringt oder wenn er für eine noch zu erbringende Leistung eine Anzahlung erhält. Ist Umsatzsteuer entstanden, kann sie zugunsten des Unternehmers berichtigt werden, wenn für eine vereinbarte Leistung ein Entgelt entrichtet worden ist, der Unternehmer die Leistung aber nicht ausführt.Sachverhalt: Der Kläger betrieb ein Fitnessstudio, das er aufgrund der behördlichen Corona-Maßnahmen im Zeitraum vom 17.3.2020 bis 17.5.2020 schließen musste. Er informierte seine Mitglieder über die Schließung und bot ihnen u.a. eine kostenlose Verlängerung der Mitgliedschaft um drei Monate, verschiedene Fitnesskurse im Internet-Streaming, die Nutzung einer „Telefon-Hotline“ sowie einen kostenlosen 3D-Körperscan an; allerdings standen die Online-Kurse auch Nicht-Mitgliedern offen. Von den ca. 800 Mitgliedern zahlten 761 Mitglieder die Beiträge im Zeitraum vom 17.3.2020 bis 17.5.2020 weiter; von den 761 Mitgliedern nahmen 85 Mitglieder die Bonus-Monate in Anspruch, und insgesamt nur 40 Mitglieder verlangten die Beiträge zurück. Der Kläger hielt die von ihm im Schließungszeitraum eingezogenen Mitgliedsbeiträge für nicht umsatzsteuerbar. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) folgte dem nicht: Die für den Zeitraum März bis Mai 2020 gezahlten Mitgliedsbeiträge waren umsatzsteuerbar, da sie ein Entgelt für die Leistung des Klägers darstellten. Der Kläger hatte nämlich die monatliche Nutzungsmöglichkeit des Fitnessstudios angeboten und hierfür Beiträge erhalten; zwischen dieser monatlichen (Teil-)Leistung und der Zahlung des Mitgliedsbeitrags bestand ein unmittelbarer Zusammenhang. Außerdem hatte der Kläger seinen Mitgliedern drei kostenlose Bonus-Monate zugesagt. Die Mitgliedsbeiträge stellten damit jedenfalls eine umsatzsteuerbare Anzahlung dar. Umsatzsteuerlich kommt es nur auf den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen der Beitragszahlung und den angebotenen Bonus-Monaten an. Unbeachtlich ist, ob bezüglich der kostenlosen Vertragsverlängerung eine zivilrechtlich wirksame Vereinbarung zwischen dem Kläger und den Mitgliedern zustande gekommen ist. Ferner kommt es nicht darauf an, dass nur 85 Mitglieder die Bonus-Monate in Anspruch genommen haben. Offenbleiben konnte die Frage, ob die während der Schließung des Studios angebotenen Live-Kurse, die „Telefon-Hotline“ und der kostenlose 3D-Körperscan ebenfalls umsatzsteuerbare Leistungen dargestellt haben. Gegen eine Umsatzsteuerbarkeit der Live-Kurse sprach, dass diese für jedermann zugänglich und kostenlos waren. Hinweise: Da der Kläger das Fitnessstudio im Schließungszeitraum den Mitgliedern tatsächlich nicht zur Verfügung stellen konnte, kommt zwar eine Berichtigung der Umsatzsteuer zu seinen Gunsten in Betracht. Die Berichtigung ist aber erst dann möglich, wenn und soweit er die Beiträge zurückzahlt. Im Streitfall hat der Kläger in nur 40 Fällen (bei ca. 800 Mitgliedern) die Beiträge zurückgezahlt, und dies auch erst in einem späteren Zeitraum. Daher kann er die Umsatzsteuer bezüglich der Beiträge der 40 Mitglieder erst im Monat der jeweiligen Rückzahlung berichtigen, während er in den verbleibenden 761 Fällen die Umsatzsteuer mangels Rückzahlung des Mitgliedsbeitrags nicht berichtigen kann.Quelle: BFH, Urteile vom 13.11.2024 – XI R 5/23 und XI R 36/22; NWB