Aktuelles
-

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse März 2025
Das Bundesfinanzministerium hat die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat März 2025 bekannt gegeben. Die monatlich fortgeschriebene Übersicht 2025 können Sie auf der Homepage des BMF abrufen.Quelle: BMF, Schreiben vom 1.4.2025 – III C 3 – S 7329/00014/007/038 (COO.7005.100.3.11614007); NWB
-
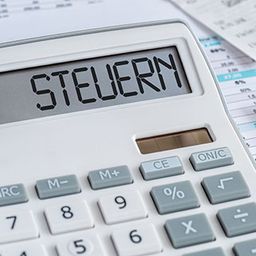
Keine Gemeinnützigkeit für Cannabis-Anbauvereinigungen
Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt am Main sind Cannabis-Anbauvereinigungen nicht gemeinnützig. Es fehlt an der sog. Selbstlosigkeit.Hintergrund: Die steuerliche Gemeinnützigkeit setzt voraus, dass die Körperschaft bzw. der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Dabei müssen diese Zwecke selbstlos gefördert werden; dies bedeutet insbesondere, dass nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke – z.B. gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke – verfolgt werden. Seit der Legalisierung von Cannabis können Cannabis-Anbauvereinigungen gegründet werden, die in der Regel als sog. Cannabis Social Clubs bezeichnet werden und seit dem 1.7.2024 eine Genehmigung für den Cannabis-Anbau beantragen können. Anbauvereinigungen bauen Cannabis an und geben das Cannabis an ihre Mitglieder ab. Wesentlicher Inhalt der Verfügung der OFD Frankfurt a.M.: Für die Gemeinnützigkeit fehlt es an der Selbstlosigkeit. Gemeinnützige Vereine dürfen nämlich nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen. Der Zweck einer Cannabis-Anbauvereinigung ist der gemeinschaftliche und nichtgewerbliche Eigenanbau von Cannabis und die Weitergabe des angebauten Cannabis zum Eigenkonsum durch Mitglieder und an Mitglieder. Dieser Zweck ist nicht selbstlos.Hinweise: Gemeinnützige Körperschaften sind grundsätzlich steuerbefreit. Außerdem können sie Spenden empfangen und hierfür Spendenbescheinigungen ausstellen, so dass der Spender seine Spende steuerlich als Sonderausgabe absetzen kann. Da Cannabis-Anbauvereinigungen keinen Gewinn anstreben dürfen, dürfte die fehlende Gemeinnützigkeit insoweit für sie verkraftbar sein. Unterstützer von Cannabis-Anbauvereinigungen können Spenden jedoch nicht steuerlich absetzen. Quelle: OFD Frankfurt a.M. vom 9.12.2024 – S 0171 A – 00990-0357 – St 53; NWB
-

Solidaritätszuschlag (noch) verfassungsgemäß
Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 zurückgewiesen. Nach Auffassung der Richter ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags noch verfassungsgemäß.Hintergrund: Der Solidaritätszuschlag wurde zunächst vom 1.7.1991 bis zum 30.6.1992 und wird seit dem 1.1.1995 zur Finanzierung der mit der deutschen Einheit verbundenen Kosten als sog. Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer erhoben. Bei der Einkommensteuer gilt für die Erhebung des Solidaritätszuschlags eine Freigrenze. Diese Freigrenze wurde ab dem Jahr 2021 deutlich angehoben, sodass ein Großteil der Einkommensteuerpflichtigen nicht mehr mit dem Solidaritätszuschlag belastet wird.Sachverhalt: Die Beschwerdeführer des Verfahrens verfolgen das Ziel der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags mit Wirkung zum 1.1.2020. Sie sind der Auffassung, dass die Weitererhebung des ursprünglich mit den Kosten der Wiedervereinigung begründeten Solidaritätszuschlags mit dem Auslaufen des sog. Solidarpakts II am 31.12.2019 verfassungswidrig geworden ist. Darüber hinaus verstoße der Solidaritätszuschlag gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, da er bei der Einkommensteuer nur noch zulasten von Besserverdienern erhoben wird.Entscheidung: Die Richter des BVerfG wiesen die Verfassungsbeschwerde zurück: Der zum 1.1.1995 eingeführte Solidaritätszuschlag stellt eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Grundgesetzes dar. Eine solche Ergänzungsabgabe setzt einen aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarf des Bundes voraus, der durch den Gesetzgeber allerdings nur in seinen Grundzügen zu umreißen ist. Im Fall des Solidaritätszuschlags ist dies der wiedervereinigungsbedingte finanzielle Mehrbedarf des Bundes. Ein evidenter Wegfall des Mehrbedarfs begründet eine Verpflichtung des Gesetzgebers, die Abgabe aufzuheben oder ihre Voraussetzungen anzupassen. Insoweit trifft den Bundesgesetzgeber – bei einer länger andauernden Erhebung einer Ergänzungsabgabe – eine Beobachtungsobliegenheit. Ein offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals neuen Länder zurückzuführenden Mehrbedarfs des Bundes kann auch heute (noch) nicht festgestellt werden. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Aufhebung des Solidaritätszuschlags ab dem Veranlagungszeitraum 2020 bestand und besteht demnach nicht.Hinweis: Aus der Entscheidung folgt nicht, dass der Solidaritätszuschlag unbegrenzt weiter erhoben werden darf. Sollte der wiedervereinigungsbedingte finanzielle Mehrbedarf des Bundes evident entfallen sein, muss der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe abgeschafft werden. Wann dies der Fall sein wird, ließen die Richter offen.Quelle: BVerfG, Urteil v. 26.3.2025 – 2 BvR 1505/20; NWB
