Aktuelles
-
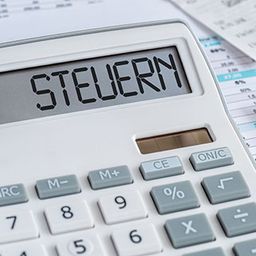
Beachtung einer Vollmacht in der Vollmachtsdatenbank
Hat der Steuerberater eine uneingeschränkte, auf dem amtlichen Muster der Finanzverwaltung ausgestellte Vollmacht seines Mandanten, die auch die Bekanntgabe von Steuerbescheiden umfasst, in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt, muss das Finanzamt diese Vollmacht bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden beachten und den Bescheid an den Steuerberater – und nicht an den Mandanten – übersenden. Es ist nicht erforderlich, dass seitens des Mandanten auch das sog. Beiblatt zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen verwendet wird. Hintergrund: Vollmachten für Steuerberater können in einer amtlichen Vollmachtsdatenbank hinterlegt werden, wenn hierfür das amtliche Vollmachtsformular verwendet wird. Auf dem Formular kann dann angekreuzt werden, ob die Vollmacht uneingeschränkt oder nur für bestimmte Steuerarten gelten soll und ob auch eine Bekanntgabevollmacht für die Entgegennahme von Steuerbescheiden erteilt wird. Die Vollmacht ist dann den Finanzämtern elektronisch zu übermitteln und von diesen zu beachten. Die Finanzverwaltung hat dem amtlichen Formular noch ein Beiblatt zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen beigefügt, in dem die Steuernummer(n) des Steuerpflichtigen mit dem jeweiligen Finanzamt anzugeben sind, für die die Vollmacht gelten soll. Sachverhalt: Der Kläger bevollmächtigte seinen Steuerberater S für alle Steuerarten und für den Empfang sämtlicher Steuerbescheide (Bekanntgabevollmacht); die Vollmacht enthielt also keine Beschränkungen für bestimmte Steuerarten. Der Kläger verwendete das amtliche Vollmachtsmuster der Finanzverwaltung. Auf dem Vollmachtsmuster war sowohl die Steueridentifikationsnummer des Klägers als auch seine Steuernummer für die Einkommensteuer angegeben. Die Vollmacht enthielt jedoch nicht das Beiblatt zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen. Die Vollmacht wurde in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt und konnte vom Finanzamt seit dem 20.6.2017 abgerufen werden. Im Juni 2018 erwarb der Kläger ein Grundstück. Das Finanzamt setzte Grunderwerbsteuer mit Bescheid vom 27.6.2018 fest, den es dem Kläger selbst – und nicht dem S – bekanntgab. Der Kläger übergab den Bescheid dem S am 9.9.2019, also nach mehr als 14 Monaten. S legte am 12.9.2019 Einspruch beim Finanzamt ein, das den Einspruch als verspätet ansah und verwarf. Hiergegen erhob der Kläger Klage. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) sah den Einspruch als fristgerecht an und gab der Klage statt: Der Grunderwerbsteuerbescheid ist erst am 9.9.2019 mit der Übergabe des Bescheids durch den Kläger an den S wirksam bekanntgegeben worden, sodass der von S eingelegte Einspruch am 12.9.2019 innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist und damit fristgerecht erfolgt ist. Die Übersendung des Grunderwerbsteuerbescheids an den Kläger am 27.6.2018 war unwirksam, weil der Bescheid dem S hätte bekanntgegeben werden müssen. Denn der Kläger hatte dem S eine vollumfängliche Empfangsvollmacht erteilt, die in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt worden war und die daher den Finanzämtern elektronisch zu übermitteln war. Das Beiblatt zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen war nicht Bestandteil des amtlichen Vollmachtsmusters und musste daher vom Kläger nicht verwendet werden. Denn der Umfang der Vollmacht ergibt sich bereits aus dem eigentlichen Vollmachtsformular, so dass die Angabe der Steuernummer(n) in dem Beiblatt und die Erklärung, dass die Vollmacht nur für die in dem Beiblatt angegebenen Steuernummern gelten soll, im Widerspruch zum Vollmachtsmuster stünde, das grundsätzlich auf eine uneingeschränkte Vertretung gerichtet ist, wenn nicht bestimmte Steuerarten im Vollmachtsmuster ausdrücklich ausgeschlossen werden. Da die Bekanntgabe an den Kläger unwirksam war, wurde dieser Bekanntgabemangel erst durch Übergabe des Bescheids am 9.9.2019 geheilt. Der Einspruch vom 12.9.2019 war damit fristgerecht. Inhaltlich gab es keinen Streit darüber, dass die Grunderwerbsteuer zu hoch festgesetzt worden war. Hinweise: Bei der Grunderwerbsteuer kommt die Besonderheit dazu, dass eine Steuernummer für jeden grunderwerbsteuerbaren Vorgang vergeben wird. Es ist also vorab gar nicht möglich, im Beiblatt die künftigen Grunderwerbsteuer-Steuernummern anzugeben. Das Urteil ist für Steuerpflichtige und ihre Berater erfreulich, weil der BFH deutlich macht, dass die Finanzverwaltung die auf dem amtlichen Vollmachtsmuster erteilten, und in der Vollmachtsdatenbank hinterlegten Vollmachten beachten muss und nicht auf das Fehlen des Beiblatts verweisen darf. Eine entgegen der in der Vollmachtsdatenbank hinterlegten Empfangsvollmacht erfolgte Bekanntgabe des Steuerbescheids an den Steuerpflichtigen selbst löst dann keine Einspruchsfrist aus. Quelle: BFH, Urteil vom 8.11.2023 – II R 19/21; NWB
-

Tarifermäßigung für Umsatzsteuer-Erstattungszinsen
Einem Unternehmer, der nach einem Rechtsstreit mit dem Finanzamt eine Umsatzsteuererstattung für mehrere Jahre sowie Erstattungszinsen für diese Umsatzsteuererstattung erhält, ist sowohl für die Umsatzsteuererstattung als auch für die Erstattungszinsen eine sog. Tarifermäßigung, die zu einem niedrigeren Steuersatz führt, zu gewähren. Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt für außerordentliche Einkünfte eine sog. Tarifermäßigung. Mit steigendem Einkommen steigt auch der Steuersatz (sog. Progression); diese Progressionswirkung wird aufgrund der Tarifermäßigung abgemildert. Eine der gesetzlich geregelten Fallgruppen der außerordentlichen Einkünfte sind Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten. Sachverhalt: Der Kläger ermittelte seinen Gewinn durch Bilanzierung. Aufgrund einer Steuerfahndungsprüfung für 1997 bis 2000 kam es zunächst zu hohen Umsatzsteuernachzahlungen. Er klagte gegen die Änderungsbescheide, und es kam nach mehreren Jahren im Jahr 2012 zu einer Einigung mit dem Finanzamt. Diese Einigung führte zu einer Minderung der Umsatzsteuer für 1997 bis 2000 um insgesamt ca. 320.000 € sowie zur Festsetzung von Umsatzsteuer-Erstattungszinsen in Höhe von ca. 200.000 €. Der Kläger erfasste sowohl die Umsatzsteuererstattung als auch die Erstattungszinsen in seinem Jahresabschluss zum 31.12.2012 gewinnerhöhend und beantragte die Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte. Das Finanzamt gewährte die Tarifermäßigung zwar für die Umsatzsteuererstattung, nicht aber für die Erstattungszinsen.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) erkannte die Tarifermäßigung für die Erstattungszinsen an und gab der Klage statt: Bei den Erstattungszinsen handelte es sich um außerordentliche Einkünfte, nämlich um eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit. Die Tätigkeit war in der mehrjährigen Kapitalüberlassung an das Finanzamt zu sehen, da der Kläger zu viel Umsatzsteuer an das Finanzamt überwiesen hatte. Die Tätigkeit war auch mehrjährig, weil sich die Kapitalüberlassung über mindestens zwei Veranlagungszeiträume und über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten erstreckte. Ferner war auch die Außerordentlichkeit der Einkünfte zu bejahen, weil die Einkünfte zusammengeballt im Jahr 2012 entstanden sind. Die Erstattungszinsen und die Umsatzsteuererstattung für 1997 bis 2000 waren zum 31.12.2012 gewinnerhöhend zu aktivieren und erhöhten die Progressionswirkung, d. h. den Steuersatz. Die Außerordentlichkeit zeigt sich daran, dass die Zinsen i. H. von ca. 200.000 € etwa 63 % der Umsatzsteuererstattung i. H. von ca. 320.000 € ausmachten. Zusammen machten die Umsatzsteuererstattung sowie die Erstattungszinsen fast 39 % des Gesamtbetrags der Einkünfte des Klägers (ca. 525.000 €) aus. Hinweise: Die Tarifermäßigung für die Umsatzsteuererstattung war nicht streitig, weil sie vom Finanzamt anerkannt worden war. Der BFH macht nun deutlich, dass für die Erstattungszinsen zu einer Umsatzsteuererstattung, die einen mehrjährigen Zeitraum betrifft, nichts anderes gelten kann als für die Umsatzsteuererstattung selbst: Für beide Beträge wird eine Tarifermäßigung gewährt, wenn sie jeweils mehrjährige Zeiträume (1997 bis 2000) betreffen. Handelt es sich hingegen um eine Umsatzsteuererstattung für nur ein einziges Jahr und dementsprechend auch nur um Erstattungszinsen für ein Jahr, fehlt es an der Außerordentlichkeit der Einkünfte, so dass keine Tarifermäßigung gewährt wird. Der BFH weicht in seinem aktuellen Urteil von dem Urteil eines anderen BFH-Senats aus dem Jahr 2013 ab, der die Tarifermäßigung versagt hatte. Der andere Senat hat vor dem Hintergrund der aktuellen Entscheidung aber mitgeteilt, dass er an seiner Entscheidung aus dem Jahr 2013 nicht mehr festhält. Quelle: BFH, Urteil vom 30.8.2023 – X R 2/22; NWB
-

Organschaft bei unterjähriger Verschmelzung
Wird bei einer körperschaftsteuerlichen Organschaft der Organträger im Laufe des Wirtschaftsjahrs auf eine Personen- oder Kapitalgesellschaft verschmolzen, tritt die übernehmende Personen- oder Kapitalgesellschaft aufgrund der Verschmelzung in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, so dass die bislang bestehende finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger ganzjährig besteht und die Organschaft steuerlich anzuerkennen ist.Hintergrund: Bei einer körperschaftsteuerlichen Organschaft zwischen einem Organträger und einer Organgesellschaft wird das Einkommen der Organgesellschaft dem Organträger zugerechnet und von diesem versteuert. Eine Organschaft setzt u.a. einen Ergebnisabführungsvertrag sowie eine finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger ununterbrochen vom Beginn des Wirtschaftsjahrs voraus; der Organträger muss also bei einem Wirtschaftsjahr, das dem Kalenderjahr entspricht, vom 1.1. an die Stimmrechtsmehrheit bei der Organgesellschaft haben.Sachverhalt: Der Bundesfinanzhof (BFH) musste über drei Fälle entscheiden, in denen am 1.1. des Wirtschaftsjahrs eine Organschaft bestand und im Laufe des Jahres der Organträger (OT 1) auf eine Kapitalgesellschaft oder auf eine Personengesellschaft (OT 2) verschmolzen wurde. Die jeweilige Verschmelzung erfolgte zwar mit einer sog. Rückwirkung, aber nicht auf den 1.1., sondern auf einen späteren Stichtag, z.B. den 1.4. Die jeweilige Organgesellschaft rechnete ihr Einkommen dem jeweiligen Organträger (OT 1 bzw. OT 2) am 31.12. zu. Das Finanzamt verneinte eine Organschaft, weil die finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft zur übernehmenden OT 2 nicht von Beginn des Wirtschaftsjahrs an bestanden habe, sondern erst ab dem 1.4.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab den hiergegen gerichteten Klagen im Grundsatz statt: Die für eine Organschaft erforderliche finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger war in den Streitfällen zu bejahen. Denn es bestand durchgängig von Beginn des Wirtschaftsjahrs an eine Mehrheitsbeteiligung eines Organträgers an der Organgesellschaft. Zwar war die Organgesellschaft nur vom 1.4. bis zum 31.12. in den OT 2 finanziell eingegliedert und nicht bereits vom 1.1. an. Jedoch wird dem OT 2 die vom 1.1. bis 31.3. bestehende finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in den OT 1 zugerechnet. Denn aufgrund der Verschmelzung ist der OT 2 Rechtsnachfolger des OT 1 geworden, so dass ihm die finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in den OT 1 zugerechnet wird. Unbeachtlich ist somit, dass die Verschmelzung des OT 1 auf den OT 2 rückwirkend nur auf den 1.4. und nicht auf den 1.1. erfolgt ist. Hinweise: Der BFH widerspricht der Finanzverwaltung, die erst ab dem rückwirkenden Übertragungsstichtag (im o. g. Fall der 1.4.) eine finanzielle Eingliederung bejaht, so dass eine Organschaft nur dann anzunehmen ist, wenn die Umwandlung bzw. Verschmelzung rückwirkend zum 1.1. erfolgt. Quelle: BFH, Urteile vom 11.7.2023 – I R 21/20 (unterjährige Verschmelzung auf Personengesellschaft), I R 36/20 und I R 45/20 (jeweils unterjährige Verschmelzung auf Kapitalgesellschaft); NWB
