Aktuelles
-

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse November 2025
Das Bundesfinanzministerium hat die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat November 2025 bekannt gegeben. Die monatlich fortgeschriebene Übersicht 2025 können Sie auf der Homepage des BMF abrufen.Quelle: BMF, Schreiben v. 1.12.2025 – III C 3 – S 7329/00014/007/165; NWB
-

Auflösung einer fehlerhaft gebildeten Rücklage im Folgejahr
Wird eine Rücklage, mit der ein Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf einer Immobilie neutralisiert worden ist, zu Unrecht gebildet und ist der Steuerbescheid für das Jahr der Bildung bestandskräftig, ist die fehlerhaft gebildete Rücklage in dem ersten Folgejahr, das verfahrensrechtlich noch offen ist, gewinnerhöhend aufzulösen. Hintergrund: Ein Gewinn aus der Veräußerung einer betrieblichen Immobilie, die zu einer inländischen Betriebsstätte gehört, kann durch eine Rücklage neutralisiert werden, die grundsätzlich innerhalb von vier Jahren auf ein neues Wirtschaftsgut (Immobilie oder Schiff) übertragen werden muss (sog. Reinvestition). Die Rücklage mindert dann die Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen auf das neue Wirtschaftsgut. Unterbleibt eine Reinvestition, muss die Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst werden und wird um einen sog. Gewinnzuschlag von 6 % des Rücklagenbetrags jährlich erhöht.Sachverhalt: Klägerin war eine GmbH, die im Jahr 2002 ihren Immobilienbestand mit Gewinn veräußerte. Sie stellte den Gewinn in ihrer Steuerbilanz zum 31.12.2022 in eine Rücklage ein, um den Gewinn zu neutralisieren und auf eine neue Immobilie zu übertragen. Die Körperschaftsteuerfestsetzung für 2002 wurde bestandskräftig. Es kam zu einer Außenprüfung für 2002 und die Folgejahre. Der Außenprüfer war der Auffassung, dass die Rücklage im Jahr 2002 nicht hätte gebildet werden dürfen, weil die Klägerin seit dem Jahr 2000 keine Betriebsstätte mehr im Inland gehabt habe. Der Prüfer löste die Rücklage daher zum 31.12.2003 auf; die Steuerfestsetzung für 2003 war – im Gegensatz zur Steuerfestsetzung für 2002 – noch änderbar. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die Auflösung der Rücklage zum 31.12.2003 für möglich, wies die Sache aber an das Finanzgericht zur weiteren Aufklärung zurück: Das Finanzamt durfte eine fehlerhaft gebildete Rücklage zum 31.12.2003 gewinnerhöhend auflösen. Dies ergibt sich aus den Grundsätzen des sog. formellen Bilanzenzusammenhangs. Danach ist ein Bilanzierungsfehler zwar grundsätzlich vorrangig in dem Jahr, in dem der Fehler geschehen ist, zu korrigieren. Ist der Steuerbescheid für dieses Jahr aber bereits bestandskräftig, ist der Fehler in der Schlussbilanz des ersten Folgejahres, für das der Steuerbescheid noch geändert werden kann, zu korrigieren. Diese Grundsätze gelten auch bei einer Rücklage, in die ein Gewinn aus der Veräußerung der Immobilie eingestellt worden ist. Zwar bildet die Rücklage Eigenkapital ab, das an sich nur einen Saldo in der Bilanz darstellt. Dennoch ist für die Rücklage in der Steuerbilanz ein eigenständiger Passivposten auszuweisen, so dass für diesen Passivposten die gleichen Grundsätze gelten wie für die Bilanzposten der anderen Wirtschaftsgüter. Da die Steuerfestsetzung für das Jahr 2002, in dem der Fehler nach Angaben des Außenprüfers passiert war, bereits materiell bestandskräftig war und nicht mehr geändert werden konnte, musste der Fehler in dem ersten Jahr, das verfahrensrechtlich noch offen war, korrigiert werden. Dies war das Jahr 2003, so dass die Rücklage an sich zum 31.12.2003 gewinnerhöhend aufgelöst werden konnte. Hinweise: Der BFH hat die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen, weil noch zu prüfen ist, ob die Bildung der Rücklage zum 31.12.2002 wirklich fehlerhaft war. Dies wäre der Fall, wenn die Klägerin seit dem Jahr 2000 keine Betriebsstätte mehr im Inland gehabt hätte. Sollte die Rücklage im Jahr 2002 aber zu Recht gebildet worden sein, hätte die Klage Erfolg, weil dann das Finanzamt die Rücklage nicht zum 31.12.2003 auflösen dürfte. Quelle: BFH, Urteil vom 2.7.2025 – XI R 27/22; NWB
-
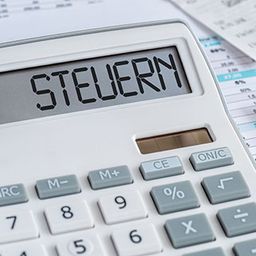
Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer freiwilligen Pflegezusatzversicherung
Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen für eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung, die der (teilweisen) Absicherung von nicht durch die Pflege-Pflichtversicherung gedeckten Kosten wegen dauernder Pflegebedürftigkeit dient, ist verfassungsrechtlich nicht geboten, da der Gesetzgeber sich bewusst für ein Teilleistungssystem entschieden hat.Hintergrund: Nach der ab 2010 geltenden Rechtslage sind Beiträge zur Basis-Krankenversicherung, die zur Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich ist, und zur gesetzlichen Pflegeversicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar.Demgegenüber werden Aufwendungen für einen darüberhinausgehenden Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz und sonstige Vorsorgeaufwendungen mit Ausnahme von Altersvorsorgebeiträgen (also z.B. Arbeitslosen-, Unfall-, Erwerbsunfähigkeits-, Haftpflicht- und Risikoversicherungen) nur im Rahmen eines gemeinsamen Höchstbetrags steuerlich berücksichtigt, der allerdings regelmäßig bereits durch die Beiträge zur Basisabsicherung ausgeschöpft wird.Sachverhalt: Die Kläger hatten jeweils eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, mithilfe derer sie die finanziellen Lücken schließen wollten, die sich im Falle dauernder Pflegebedürftigkeit vor allem bei höheren Pflegegraden aufgrund der den tatsächlichen Bedarf nicht abdeckenden Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung ergäben. Die hierfür aufgewendeten Beiträge blieben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung aufgrund der anderweitigen Ausschöpfung des Höchstbetrags ohne steuerliche Auswirkung. Hiergegen wandten sich die Kläger mit Ihrer Klage und machten im Kern Folgendes geltend: So, wie der Sozialhilfeträger die Heimpflegekosten des Sozialhilfeempfängers übernehme, müssten auch die Beiträge für ihre Zusatzversicherungen, die lediglich das sozialhilfegleiche Versorgungsniveau im Bereich der Pflege gewährleisteten, zur Wahrung der Steuerfreiheit des Existenzminimums einkommensteuerrechtlich berücksichtigt werden.Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) folgte dieser Argumentation nicht. Das Gericht hält die gesetzliche Beschränkung des Sonderausgabenabzugs für verfassungsgemäß und hat von einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht abgesehen.Der Gesetzgeber hat die gesetzlichen Pflegeversicherungen bewusst und in verfassungsrechtlich zulässiger Weise lediglich als Teilabsicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit ausgestaltet. Hierbei sind nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung abgedeckte Kosten in erster Linie durch Eigenanteile der pflegebedürftigen Personen aus ihren Einkommen oder ihrem Vermögen aufzubringen.Dementsprechend besteht für den Gesetzgeber keine verfassungsrechtliche Pflicht, auch die über das Teilleistungssystem hinausgehenden Leistungen steuerlich zu fördern und insoweit mitzufinanzieren. Das Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums erfordert lediglich, dass der Staat diejenigen Beiträge für Pflegeversicherungen steuerlich freistellen muss, die der Gesetzgeber als verpflichtende Vorsorge ansieht und die nicht über das sozialhilferechtliche Niveau hinausgehen. Dies ist bei einer freiwilligen privaten Pflegezusatzversicherung nicht der Fall.Quelle: BFH, Urteil vom 24.7.2025 – X R 10/20; NWB
