Aktuelles
-
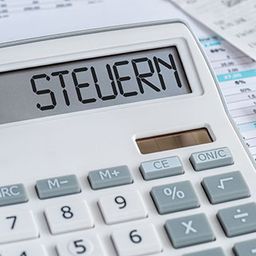
Steuerhinterziehung durch Unterlassen der Abgabe der Steuererklärung
Eine Steuerhinterziehung kann auch dadurch begangen werden, dass die Steuererklärung nicht abgegeben wird, so dass das Finanzamt keine Kenntnis von den Einkünften erlangt. Eine Kenntnis des Finanzamts ist auch dann zu verneinen, wenn dem Finanzamt elektronische Daten von einem Dritten wie z.B. dem Arbeitgeber übermittelt werden, diese Daten aber nicht automatisch der Steuerakte des Steuerpflichtigen zugeordnet werden, sondern nur auf einem Datenspeicher des Finanzamts mit der Steuernummer des Steuerpflichtigen gespeichert werden und dort zum Abruf bereitstehen. Hintergrund: Grundsätzlich beträgt die Festsetzungsfrist vier Jahre. Sie verlängert sich im Fall einer leichtfertigen Steuerverkürzung auf fünf Jahre und im Fall einer vorsätzlichen Steuerverkürzung auf zehn Jahre. Sachverhalt: Die Kläger sind Eheleute. Bis einschließlich 2008 war nur der Ehemann Arbeitnehmer, so dass keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bestand (sog. Antragsveranlagung). In den Streitjahren 2009 und 2010 war auch die Ehefrau Arbeitnehmerin. Da die Ehefrau die Steuerklasse III und der Ehemann die Steuerklasse V hatte, bestand nun eine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung; allerdings erfasste das Finanzamt die Kläger zu Unrecht weiterhin als Fall einer Antragsveranlagung. Für 2009 und 2010 gaben die Kläger keine Steuererklärungen ab; allerdings übermittelten die Arbeitgeber der Kläger dem Finanzamt die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen. Die Bescheinigungen wurden nicht in der Steuerakte der Kläger erfasst, sondern nur im Datenverarbeitungsprogramm des Finanzamts unter der Steuernummer der Kläger abrufbereit gespeichert. Im Jahr 2018 fiel dem Finanzamt bei einer elektronischen Überprüfung auf, dass die Kläger zur Abgabe von Steuererklärungen für die Jahre 2009 und 2010 verpflichtet gewesen wären. Es erließ daher im Juni 2018 Schätzungsbescheide für beide Jahre. Hiergegen wehrten sich die Kläger. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt eine verlängerte Festsetzungsfrist wegen einer Steuerverkürzung für denkbar und hat die Sache an das Finanzgericht (FG) zurückverwiesen: Die Festsetzungsfrist beginnt zwar grundsätzlich mit Ablauf des Jahres, in dem die Steuer entstanden ist. Besteht allerdings eine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung, beginnt sie erst mit der Abgabe der Steuererklärung, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist. Im Streitfall bestand eine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung, so dass die Festsetzungsverjährung für 2009 mit Ablauf des 31.12.2012 und für 2010 mit Ablauf des 31.12.2013 begann und mit Ablauf des 31.12.2016 (für 2009) bzw. 31.12.2017 (für 2010) endete. Allerdings kommt eine Verlängerung der Festsetzungsfrist von vier Jahren auf fünf oder zehn Jahre in Betracht, falls die Kläger eine Steuerverkürzung begangen haben sollten. Eine Steuerverkürzung kann durch Unterlassen der Abgabe der Steuererklärung begangen werden, wenn hierdurch das Finanzamt über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen wird. Im Streitfall wird die Steuerverkürzung nicht dadurch ausgeschlossen, dass dem Finanzamt die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen von den Arbeitgebern übermittelt worden waren. Denn es kommt entscheidend auf die Kenntnis derjenigen Finanzbeamten an, die für die Bearbeitung der Steuererklärung zuständig sind. Bei ihnen ist zwar eine Kenntnis des gesamten Inhalts der Papierakte bzw. elektronischen Akte zu unterstellen. Dies gilt jedoch nicht für elektronische Daten, die nicht in der Papierakte bzw. elektronischen Akte gespeichert bzw. (nach Ausdruck) abgelegt werden, sondern nur allgemein auf einem Datenspeicher mit der Steuernummer des Steuerpflichtigen gespeichert werden und dort abrufbar sind. Das FG muss daher nun prüfen, ob den Klägern Leichtfertigkeit oder Vorsatz zu unterstellen ist, so dass eine leichtfertige Steuerverkürzung mit einer fünfjährigen Verjährungsfrist oder eine vorsätzliche Steuerverkürzung mit einer zehnjährigen Verjährungsfrist in Betracht kommt. Hinweise: Bei einer leichtfertigen Steuerverkürzung hätte sich die Verjährungsfrist für 2009 nur bis zum 31.12.2018 verlängert, so dass die Klage insoweit Erfolg hätte. Da selbst das Finanzamt nicht erkannt hat, dass seit 2009 die Voraussetzungen einer Pflichtveranlagung vorlagen, wird das FG voraussichtlich eine Leichtfertigkeit und damit erst recht einen Vorsatz verneinen.Eine Einkommensteuerverkürzung durch Unterlassen ist vollendet, wenn das Finanzamt die wesentlichen Veranlagungsarbeiten für das entsprechende Jahr abgeschlossen hat. Dies war bezüglich des Veranlagungszeitraums für 2009 am 31.3.2011 der Fall, da das Finanzamt an diesem Tag die wesentlichen Veranlagungsarbeiten für 2009 zu 95 % abgeschlossen hatte; hinsichtlich des Veranlagungszeitraums 2010 hatte das Finanzamt am 31.3.2012 die wesentlichen Veranlagungsarbeiten für 2010 abgeschlossen.Quelle: BFH, Urteil vom 14.5.2025 – VI R 14/22; NWB
-

Doppelte Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Anteilen an einer grundbesitzenden GmbH
Der Erwerb von Anteilen an einer GmbH, die Grundbesitz hält, kann zweimal Grunderwerbsteuer auslösen, wenn zunächst nur der Vertrag über den Anteilsverkauf abgeschlossen wird (sog. Signing) und die Anteile später übertragen werden (sog. Closing). Selbst wenn die doppelte Festsetzung rechtswidrig sein sollte, ist jedenfalls die Festsetzung von Grunderwerbsteuer gegenüber der GmbH für die Anteilsübertragung (sog. Closing) rechtlich nicht zweifelhaft.Hintergrund: Grunderwerbsteuer entsteht nicht nur beim Verkauf eines Grundstücks, sondern auch, wenn mindestens 90 % der Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft innerhalb von zehn Jahren auf neue Gesellschafter übergehen oder wenn ein Anteilserwerber nunmehr mit mindestens 90 % beteiligt ist. Das Gesetz knüpft in unterschiedlichen Regelungen teils an den Verkaufsvertrag, also an das Verpflichtungsgeschäft (sog. Signing), und teils an die Übertragung der Anteile, also an die Erfüllung des Verpflichtungsgeschäfts (sog. Closing), an.Sachverhalt: Die Antragstellerin war eine GmbH, die Grundbesitz hielt. Ihre alleinige Anteilseignerin war die H-GmbH. Die H-GmbH verkaufte mit Vertrag vom 22.3.2024 ihre gesamten Anteile an die M-GmbH; die Übertragung der GmbH-Anteile sollte jedoch erst nach der Bezahlung des Kaufpreises erfolgen, der zum 2.4.2024 fällig wurde. Am 2.4.2024 zahlte die M-GmbH den Kaufpreis, so dass die Abtretung der GmbH-Anteile an die M-GmbH an diesem Tag erfolgte. Das Finanzamt setzte nun zweimal Grunderwerbsteuer fest: einmal gegenüber der M-GmbH wegen des Verkaufsvertrags vom 22.3.2024 und ein weiteres Mal gegenüber der Antragstellerin aufgrund der Anteilsabtretung, die zu einem Wechsel im Gesellschafterbestand der Antragstellerin im Umfang von mindestens 90 % geführt hatte. Die Antragstellerin legte gegen ihren Grunderwerbsteuerbescheid Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung des Bescheids. Nachdem das Finanzgericht die Aussetzung der Vollziehung abgelehnt hatte, kam der Fall zum BFH.Entscheidung: Der BFH lehnte die Aussetzung der Vollziehung des gegenüber der Antragstellerin ergangenen Grunderwerbsteuerbescheids ab: Es bestanden keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des gegenüber der Antragstellerin ergangenen Bescheides. Ändert sich innerhalb von zehn Jahren der Gesellschafterbestand einer Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar in der Weise, dass mindestens 90 % der GmbH-Anteile auf neue Gesellschafter übergehen, ist dies grunderwerbsteuerbar, wenn die GmbH Grundbesitz hält. Diese Voraussetzungen waren im Streitfall erfüllt, da die H-GmbH in einem Akt 100 % der Anteile an der Antragstellerin auf die M-GmbH übertragen hat. Die Übertragung erfolgte mit der vollständigen Kaufpreiszahlung am 2.4.2024. Steuerschuldnerin ist in einem solchen Fall die Gesellschaft, deren Anteile übertragen werden, und damit die Antragstellerin. Zwar kann die Grunderwerbsteuerfestsetzung nach dem Gesetz aufgehoben werden, wenn Grunderwerbsteuer für das sog. Signing und für das sog. anschließende Closing doppelt festgesetzt wird. Die Aufhebung betrifft nach dem Wortlaut des Gesetzes aber nur die Grunderwerbsteuer, die für das Verpflichtungsgeschäft festgesetzt worden ist (sog. Signing), nicht jedoch die Grunderwerbsteuer, die für die Anteilsübertragung (sog. Closing) festgesetzt wird. Daher könnte allenfalls die M-GmbH als Erwerberin der Anteile eine Aufhebung der Grunderwerbsteuer, die aufgrund des Vertrags vom 22.3.2024 der M-GmbH gegenüber festgesetzt worden ist, verlangen. Hinweise: Erfolgen Signing und Closing in einem Akt, wird Grunderwerbsteuer nur einmal festgesetzt. Fallen Signing und Closing aber zeitlich auseinander, droht eine doppelte Festsetzung der Grunderwerbsteuer. Hier bestehen nun zwei Möglichkeiten, eine doppelte Festsetzung zu vermeiden: Der Steuerschuldner, der Grunderwerbsteuer aufgrund des Verkaufsvertrags entrichten muss (sog. Signing), kann die Aufhebung der Grunderwerbsteuer beantragen; im Streitfall war das die M-GmbH. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn einer der beiden Erwerbsvorgänge (Signing oder Closing) dem Finanzamt nicht fristgerecht und vollständig angezeigt worden ist. Nach einer aktuellen Entscheidung des BFH bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer doppelten Grunderwerbsteuerfestsetzung. Vorrangig und damit rechtmäßig sein dürfte die Grunderwerbsteuerfestsetzung für die Übertragung der GmbH-Anteile (sog. Closing). Auch danach wäre die Grunderwerbsteuerfestsetzung im Streitfall rechtmäßig, da sie das sog. Closing betrifft. Hingegen könnte die Grunderwerbsteuerfestsetzung, die aufgrund des Vertrags erfolgt ist (im Streitfall gegenüber der M-GmbH), rechtswidrig sein, wenn dem Finanzamt im Zeitpunkt des Erlasses des entsprechenden Grunderwerbsteuerbescheids bereits bekannt war, dass die Anteilsübertragung (sog. Closing) schon erfolgt ist. Es handelt sich vorliegend jedoch nur um eine vorläufige Entscheidung im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes. Quelle: BFH, Beschluss vom 16.9.2025 – II B 23/25; NWB
-
 Arbeitslohn bei Teilnahme am „Firmenfitness-Programm“ des Arbeitgebers
Arbeitslohn bei Teilnahme am „Firmenfitness-Programm“ des ArbeitgebersDie Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD) hat sich in einer sog. Kurzinformation zur lohnsteuerlichen Behandlung der Teilnahme des Arbeitnehmers an einem „Firmenfitness-Programm“ des Arbeitgebers geäußert.Hintergrund: Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehört nicht nur das Gehalt, sondern auch ein sonstiger Vorteil, den der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als Gegenleistung für seine Arbeit gewährt, z.B. Sachbezüge oder Preisvorteile. Bei einem Firmenfitness-Programm ermöglicht der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Zugang zu einer Vielzahl von Fitnessangeboten (z.B. Yoga-Kurse, Fitness- oder Tanzstudios), indem der Arbeitnehmer einen Pass für eine Vielzahl von Angeboten in ganz Deutschland erhält. Ein geldwerter Vorteil entsteht, wenn der Arbeitnehmer für den Pass nichts oder nur einen ermäßigten Preis bezahlen muss. Wesentlicher Inhalt der Kurzinformation: Steuerpflichtig ist die Differenz zwischen dem vom Arbeitnehmer entrichteten Preis und dem üblichen Endpreis. Üblicher Endpreis ist der Preis, den ein privater Endverbraucher für ein vergleichbares Fitnessangebot am Markt zahlen müsste. Soweit die jeweilige Firmenmitgliedschaft privaten Endverbrauchern nicht oder aber nicht zu vergleichbaren Bedingungen angeboten wird, kann ein üblicher Endpreis nicht ermittelt werden. Anzusetzen sind dann die Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer und Nebenkosten. Einmalige Kosten des Arbeitgebers sind auf die Laufzeit gleichmäßig zu verteilen. Gibt es keine feste Laufzeit, ist auf den Zeitraum bis zur frühestmöglichen Kündigung abzustellen. Diese Kosten sind auf alle Arbeitnehmer aufzuteilen, die an dem Programm teilnehmen könnten, falls die Kosten unabhängig von der Anzahl der registrierten Arbeitnehmer entstehen. Hinweis: Ein geldwerter Vorteil entsteht aber nur bei denjenigen Arbeitnehmern, die das Angebot zum Firmenfitness-Programm annehmen, weil ihnen der Arbeitgeber eine Teilnahmeberechtigung eingeräumt hat. Es kommt dann nicht darauf an, ob und inwieweit der Arbeitnehmer das einzelne Angebot tatsächlich nutzt. Entstehen dem Arbeitgeber Kosten, die er direkt einem Arbeitnehmer zuordnen kann, sind die Kosten dem einzelnen Arbeitnehmer zuzuordnen. Hinweis: Bei Aufteilung der laufenden Kosten auf die registrierten Arbeitnehmer muss der Arbeitgeber monatlich prüfen, ob die laufenden Kosten ggf. neu zu berechnen sind, z.B. weil sich die Anzahl der registrierten Arbeitnehmer geändert hat. Hinweise: Die Teilnahmeberechtigung am Firmenfitness-Programm wird als Sachbezug eingestuft, der steuerfrei und sozialversicherungsfrei bleibt, sofern er – zusammen mit anderen Sachbezügen – maximal 50 € im Monat nicht überschreitet. Es handelt sich allerdings um eine Freigrenze, so dass eine Überschreitung des Betrags von 50 € auch nur um einen Euro zur Steuer- und Sozialversicherungspflicht des gesamten geldwerten Vorteils führt. Die OFD fordert die Finanzämter zu einer Überprüfung bereits erteilter Lohnsteuer-Anrufungsauskünfte auf; denkbar ist, dass bislang eine Versteuerung unterblieben ist, weil die Teilnahmeberechtigung am Firmenfitness-Programm nicht als geldwerter Vorteil eingestuft worden ist. Allerdings sollte dem Arbeitgeber in einem solchen Fall Gelegenheit gegeben werden, Dispositionen rückgängig zu machen. Quelle: OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation vom 11.3.2025 – S 2334-14-2025-3806; NWB
